
Extremwetter liegen im Trend
klimaseite.info, 07.12.2026
Letztes Jahr ist Deutschland gut bei den Extremwettern davongekommen. Noch einmal, muss man sagen, denn auf Dauer wird dieses Glück wohl nicht von Bestand sein, weil der Klimawandel nachweislich zu mehr Extremwetterlagen weltweit führt und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass alle einen Bogen um Deutschland machen. Klimakatastrophen ausschließlich in ferner Zukunft und in weiter Ferne? Eine Illusion! Doch der Reihe nach.
Die Wissenschaftlergruppe “World Weather Attribution” (WWA) am Imperial College London, die mit zwei Institutionen in den Niederlanden kooperiert, listet für das Jahr 2025 insgesamt 157 Extremwetter auf, ein Großteil davon sei auf die Erderwärmung zurückzuführen. Die Methodik der WWA besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der ein Extremwetter im Untersuchungsjahr eintritt, im Klimamodell die Erderwärmung von mittlerweile 1,3 Grad Celsius plus herauszurechnen und die beiden Ergebnisse miteinander zu vergleichen: also eine Art Rückrechnung auf Grundlage bekannter Wetterdaten und der CO2-Emissionen. Denn mehr höhere Temperaturen und mehr CO2 in der Atmosphäre heißt: mehr Wasserdampf, mehr Energie, ergo mehr Starkregen, Hitzewellen und Stürme. Das Extremwetter hinterlässt in der zerstörten Region keine DNA, die den Täter überführen könnte. Wohl aber lässt sich mit dem Wissen der Klimaforscher die Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der Extremwetter X in der Region Y auftauchen musste. Bei der Mehrzahl der 22 genauer untersuchten Extremwettern war der Einfluss des Klimawandels bei 17 nachweisbar.
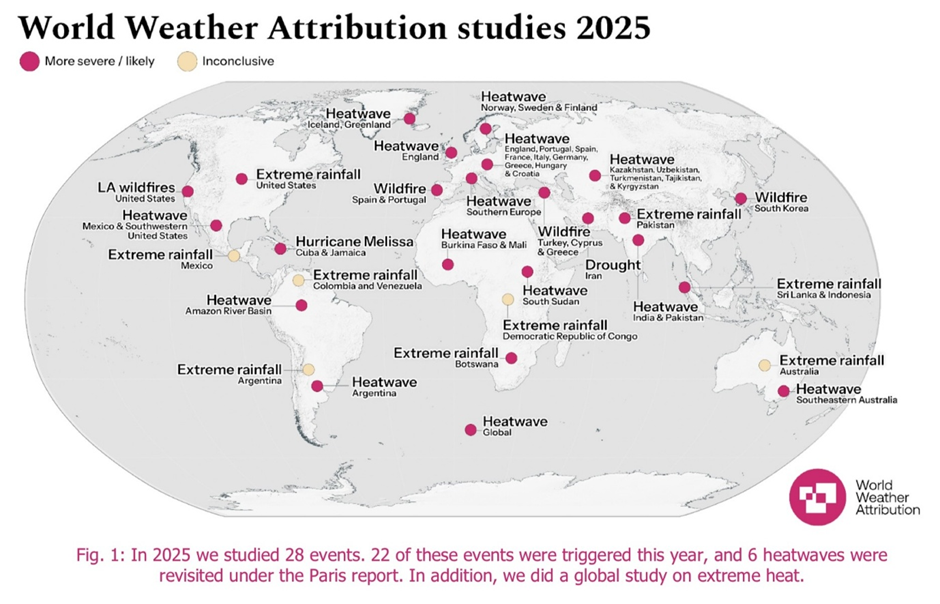
Das Wetter des Jahres 2025 in Deutschland hatte viel Sonne, wenig Regen, aber keinen Rekord zu verzeichnen. Wohl aber gab es Anfang Juli eine Hitzewelle, bei der an vielen Orten in Deutschland Temperaturen über 35 Grad Celsius gemessen wurden. Durchaus bemerkenswert, aber kein neuer Rekord. Die Deutschen wurden also anders als im Juni 2024, als halb Süddeutschland nach Starkregen überschwemmt war, von Extremwetter verschont. Die Hauptgefahr sind neben Starkregen auch Hitzeperioden. Während es in den fünfziger Jahren noch drei Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius gab, hat sich in den letzten zehn Jahren die Anzahl vervierfacht.
Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterlagen parallel zur Durchschnittstemperatur und den globalen Treibhausgas-Emissionen weiter steigt. Jedes Zehntel Grad mehr oder weniger zählt.
Quellen:
„Extremwetterkongress. Beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren“, tagesschau.de, 24.09.2025
„157 extreme Wettereignisse im Jahre 2025“, tagesschau.de, 30.12.2025
„Extremwetter hängen linear mit der globalen Erwärmung zusammen“, Tina Heni, klimareporter.de, 14.10.2025
Website des Deutschen Wetterdienstes DWD, dwd.de
“Unequal evidence and impacts, limits to adaptation: extreme weather in 2025”, worldweatherattribution.org
Die COP: überflüssiger Konferenz-Zirkus?
klimaseite.info, 04.12.2025
Die Welt schaute fasziniert auf das Spektakel an Rande des Regenwalds. Dank der 30. UN-Klimakonferenz (Conference of Parties COP) schafften es die Themen Klimaschutz und Klimawandel wieder in die Nachrichten und die Schlagzeilen, bevor sie erneut verdrängt werden von aktuellen Top News.
Klar, wenn man im nachhinein Aufwand und Ergebnis der UN-Klimakonferenzen betrachtet, macht sich Ernüchterung breit, so auch bei der COP30 vom 10.-22. November 2025. Ungefähr 50.000 Teilnehmer, eine bunte Mischung aus Politikern der teilnehmenden Nationen, Verwaltungsleuten, Lobbyisten der Öl-, Gas- oder Holzindustrie, Journalisten, NGOs und Umweltverbänden fanden sich in Belem, der brasilianischen Millionenstadt an der Amazonasmündung ein. Nicht aber offizielle Vertreter der USA, dem zweitgrößten CO2-Emittenten weltweit, was nicht durchgehend Bedauern auslöste, denn nach den Verlautbarungen und Maßnahmen der Trump-Regierung war kein konstruktiver Beitrag zu erwarten.
Die Welt schaut auf Belem
Immerhin spornte der nahende Konferenztermin viele Nationen an, die noch keine „national festgelegten Beiträge“ (NDCs) nach dem Pariser Abkommen abgegeben hatten, dies nachzuholen. (1) Auch Europa lieferte erst kurz von der COP einen neuen Zielkatalog, der sich einigermaßen brauchbar las. Aber hier wie anderswo fehlte es an zielführenden Maßnahmen, an konsequentem Handeln der Politik und an Tempo bei der Umsetzung.
Kurz vor der COP sandte das UN-Umweltprogramm UNEP noch ein Warnsignal. Mit den derzeitigen Bemühungen der Staatengemeinschaft steuere die Welt auf plus 2,8 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts zu. Vier Fünftel des CO2-Budgets, das noch einigermaßen kompatibel mit Adem 1,5 Grad-Ziel ist, seien bereits ausgeschöpft.
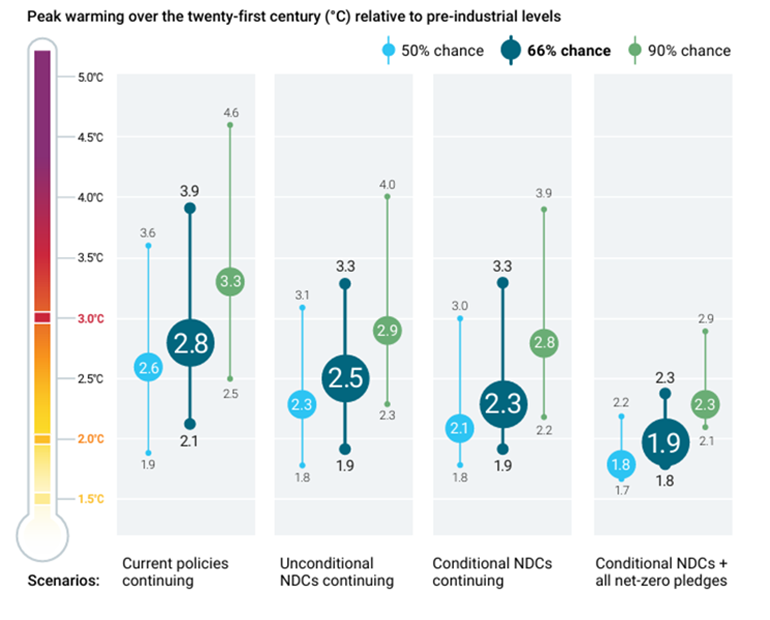
Grafik: Emissions Gap Report 2025, UNEP, Nairobi, November 2025
Dieser Warnschuss verhallte sicher nicht ungehört, aber das Ende des fossilen Zeitalters ist längst noch nicht in Reichweite, der Peak der THG-Emissionen ist vielleicht noch gar nicht erreicht. Denn fortlaufend werden neue Gas- und Ölfelder erschlossen, Ölsände abgebaut, Kohle in Kraftwerken verfeuert, kaufen die Menschen Verbrennerautos, drehen bei Kälte ihre Gasheizung hoch, buchen Flugreisen oder Kreuzfahrten. Business as usual. Wider bessere Vernunft, als gäbe es keine Erderwärmung.
Es gilt jedoch, die positiven Entwicklungen, die kleinen Fortschritte nicht aus den Augen zu verlieren, durch die UN-Klimakonferenzen und außerhalb.
Die gar nicht so kleinen Erfolge
Im Bewusstsein, dass das Klimaziel von Paris außer Reichweite gerät, beschlossen die beteiligten Staaten, die Maßnahmenumsetzung zu beschleunigen. In der Abschlusserklärung lobend hervorgehoben werden dabei die 80 Staaten, die bereits Strategien zur langfristigen Reduzierung der Treibhausgase haben. Alle Länder ohne Klimaneutralitätsziel für Mitte des Jahrhunderts werden ermuntert, dies nachzuholen.
Die bereits auf der COP29 beschlossenen Finanzhilfen für ärmere Länder in Höhe von 300 Mrd. Dollar pro Jahr sollen „organisiert“ werden. Bisher fließen nämlich im Schnitt nur etwa 26 Mrd. Dollar pro Jahr (Stand 2023). Sie sollen bis 2025 verdreifacht werden.
Mut machen dann auch die Side Events abseits der großen Bühne; Aktivitäten und Fortschritte, die es nicht in die Headlines der Medien schafften:
- Weitere Staaten sind der Allianz zum Kohleausstieg beigetreten.
- Es dürfte auch mit der Dekarbonisierung der Industrie vorangehen. Mit 30 Millionen Euro sollen Projekte zur Reduzierung von Industrieemissionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gefördert werden. Ziel ist außerdem, den Marktanteil von klimafreundlichem Stahl und Zement in den kommenden Jahren zu steigern.
- Brasilien kündigte die Schaffung einer Plattform für den CO2-Emissionshandel an, nachdem bereits 38 Länder Emissionshandelssysteme haben und 20 weitere die Einführung vorbereiten.
- Stärkung und Risikoreduzierung von klimafreundlicher Finanzierung und Geldanlage „Green Finance“
- Der Fonds zum Umgang mit Klimaschäden und finanziellen Verlusten ist inzwischen arbeitsfähig.
- Deutschland tritt der Initiative „Peatland Breakthrough“ zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Mooren bei.
- Außerdem engagiert sich Deutschland im Rahmen des „UN Climate Security Mechanism“, bei dem es darum geht, klimabedingte Konflikte, etwa den Mangel an Wasser oder Nahrungsmitteln, vor Ort zu entschärfen.
Brasilien hat eine Initiative zum Stopp der Entwaldung („Tropical Forests Forever Facility“) angestoßen. Auch Deutschland schloss sich an und sagte eine Mrd. Euro für den Waldschutzfonds zu. Norwegen will drei Mrd. US Dollar einzahlen, Brasilien und Indonesien jeweils eine Mrd. US-Dollar. Der geplante Grundstock von 25 Mrd. US-Dollar soll private Investoren anziehen und weitere 100 Mrd. aus dem Privatsektor mobilisieren. Außerdem soll ein globaler Entwaldungsstopp bis 2020 erreicht werden. Dabei sind Gelder zum Schutz des Kongobeckens vorgesehen. Auch die Rolle von Indigenen im Regenwald soll gestärkt werden. Die Abholzung der Regenwälder dürfte so zumindest gebremst werden.
Grande Finale?
Es gelang es am Ende nicht, in der Abschlusserklärung den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu konkretisieren. Nicht einmal der Begriff „fossile Energien“ findet sich dort. Der Widerstand der öl- und gasexportierenden Länder, angeführt von Russland und Saudi-Arabien, war zu stark; auch China wollte nicht mitmachen. Auf das Ziel an sich hatte man sich ja schon bei einer früheren COP in Dubai (COP 28) geeinigt. Schlussendlich erklärten sich aber 80 Länder bereit, einen Ausstiegsfahrplan zu erstellen, darunter auch Deutschland, was als Erfolg zu werten ist. Politische Beobachter gehen sogar davon aus, dass diese Initiative eine Eigendynamik mit Auswirkung auf die nächste Konferenz, die COP31 in der Türkei, entfaltet.
Aber selbst bei einer Abschlusserklärung mit Gehalt und mehr Klimaschutz wäre die Kuh noch längst nicht vom Eis. Völkerrechtlich verbindlich sind nur Verträge, wie das 2015 auf der COP 21 in Paris beschlossene und inzwischen von den meisten Staaten unterzeichnete Abkommen, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dennoch werden die 1,5 Grad höchstwahrscheinlich überschritten und selbst die Obergrenze von 2 Grad kann noch längst nicht als gesichert gelten, weil der Emissionstrend auf 2,8 Grad plus hinweist. Dieses Beispiel zeigt, dass selbst ein juristisch verbindliches Abkommen nicht ausreicht, wenn Sanktionsmechanismen fehlen. Inzwischen kann man jedoch auch davon ausgehen, dass die Welt ohne das Pariser Abkommen sogar auf 3,6 Grad plus bis Ende des Jahrhunderts zugesteuert wäre. Klimadiplomatie und speziell die Weltklimakonferenzen wirken also. Ohne Paris wäre seit 2015 etwa ein Drittel mehr Treibhausgase bis 2025 ausgestoßen worden; mit Paris wurde eine Absenkung von ca. 12 Prozent erreicht.
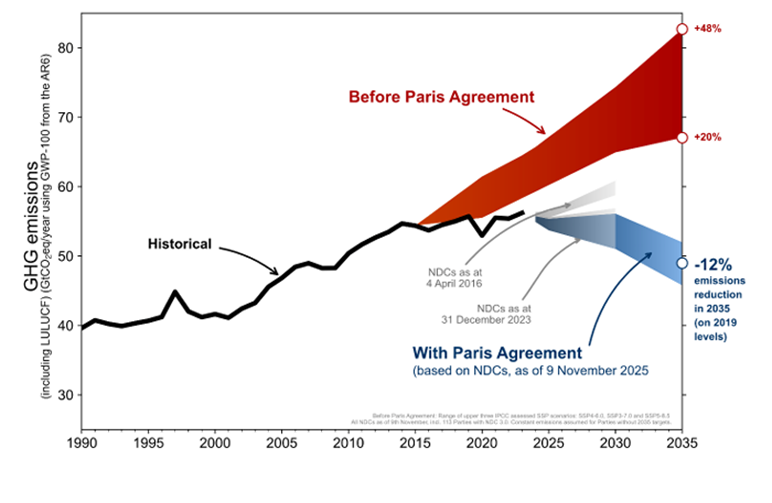
Grafik: Nationally Determined Contributions Synthesis Report – Update, UN / Climate Change Secretariat, 10.11.2025
Der Blick in die Zukunft
Nein, die UN-Klimakonferenzen sind keine nutzlose Show-Veranstaltung, auch wenn der Output in einem schlechten Verhältnis zu Aufwand zu stehen scheint, zumindest wenn man nur auf das im Konsens Vereinbarte bzw. die Abschlusserklärung schaut. Künftige UN-Klimakonferenzen könnten aber zumindest in der Außenwirkung ein Stück verlorene Glaubwürdigkeit zurückholen, wenn das Prinzip der Einstimmigkeit durch das Mehrheitsprinzip ersetzt würde.
Die COP bewegt etwas, stärkt den Klimaschutz, verdeutlicht aber auch, wie fragil die Gemeinsamkeiten der Staaten in Kampf gegen den Klimawandel sind. Letztlich sollte man nicht zu viel von ihr erwarten, zumal niemand den nationalen Regierungen, ob sie sich konstruktiv beteiligen oder nicht, die Verantwortung für die Absenkung der Treibhausgas-Emissionen abnehmen kann. (rk)
Quellen:
„2025 Synthesis Report on Nationally Determined Contributions (NDCs)”, Vereinte Nationen/FCCC, November 2025
„Weltklimakonferenz COP30: Kein Durchbruch, aber kleine Erfolge”, Website des Umweltbundesamts, 25.11.2025
„Weltklimakonferenz in Belém: Viele Fortschritte bei der Umsetzung, zu wenig bei den Verhandlungen“, Website des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 22.11.2025
„Auswahl zentraler Fortschritte im Rahmen der COP 30“, Website des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit
„Der Ausstiegsplan der Brasilianer könnte zum Wendepunkt in der Klimapolitik werden«, Interview von Susanne Götze mit Marc Weissgerber, Der Spiegel, 30.11.2025
„Global Mutirão: Uniting humanity in a global mobilization against climate change”, United Nations / FCCC, 22.11. 2025
Die Union und die Technik
klimaseite.info, 10.11.2025
Immerhin: Bundeskanzler Merz ließ es sich nicht nehmen, im Vorfeld der Un-Klimakonferenz nach Brasilien zu fliegen und für mehr Klimaschutz und Waldschutz zu werben. Deutschland wolle sich am geplanten Waldschutzfonds („Tropical Forest Forever Facility“) finanziell beteiligen, Merz sagte aber keine Summe zu. Dabei lagen schon konkrete Zusagen von anderen Staaten vor. Bemerkenswert war an seiner Agenda, die zum Erreichen der Klimaschutzziele führen soll, folgendes Bekenntnis. Zitat: „Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten.“ Klingt da die weit verbreitete Sehnsucht durch, angesichts global weiter steigender Treibhausgasemissionen durch technische Erfindungen endlich den Hebel zu einer Klimawende in die Hand zu bekommen? Da wir die mantrahaft vorgetragenen Schlüsselwörter „Innovation“ und „Technik“ in den letzten Wahlkämpfen in Endlosschleife hören mussten, nicht nur von FDP und CDU/CSU, lohnt sich ein Blick auf die politische Praxis. Wie hielt und hält es denn die Union in Regierungsverantwortung bei diesen Themen?
Erneuerbare Energien ausgebremst
In der letzten Koalition der Union mit der SPD tat der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier viel dafür, den Ausbau der Erneuerbaren Energie, vor allem der Photovoltaik und on-shore- Windkraft zu behindern. Die deutschen Solarunternehmen, einst weltweit führend, gingen reihenweise pleite, die Modulfertigung wanderte nach China, wo inzwischen über 90 % der Module hergestellt werden. Bei der Windkraft sorgten unnötige Abstandsregeln nach dem Muster der bayerischen 10h-Regel für Sand im Getriebe. Diese Bremsen wurden erst vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck und seiner Ampelregierung gelockert, so dass zum Start von Schwarz- Rot bereits 54,4 % des Stromverbrauchs aus EE kamen.
Technik, die nicht ins ideologische Schema passt
Eher fortschritts- und innovationsfeindlich zeigte sich die Union auch während der drei Jahre Ampelregierung nicht nur beim Thema Stromerzeugung, sondern auch bei technischen Anwendungen, speziell im Rahmen der notwendigen Elektrifizierung. Notwendig deshalb, weil der Strom bei Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger automatisch als Alternative auf den Plan tritt. Obwohl Habecks „Heizungsgesetz“ (korrekt: „Gebäudeenergiegesetz“) neben elektrischen Wärmepumpen mehrere andere Heiztechniken weiterhin zuließ, führte die Fundamentalopposition der Union, die glaubte, auf der Welle der BILD-Kampagne reiten zu müssen, zu großer Verunsicherung der Verbraucher, sehr zum Missfallen der Heizungsbranche. Die elektrische Wärmepumpe hatte jahrelang mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Erst jetzt scheint sich der Wind allmählich zu drehen und Vielen wird klar, dass Wärmepumpen nicht nur die klimafreundlichere Lösung im Vergleich zur Gasheizung darstellen, sondern im Betrieb auch die günstigere.
Die Union will auch den Schuss bei den Elektroautos nicht hören und versucht krampfhaft, die Fertigung der Verbrenner zu unterstützen. Obwohl seit mindestens fünf Jahren klar ist, dass Benzin-und Dieselmotoren ineffizienter, klima- und gesundheitsschädlicher als der Elektroantrieb sind und deshalb keine Zukunft haben (dürfen). China ist nicht nur rechtzeitig auf den anfahrenden Zug aufgesprungen, sondern steuert ihn inzwischen, während Deutschland im Bahnhof hinterherschaut.
Die Flucht in die Zukunft
Weil die Union in der fossilen Vergangenheit verhaftet, die Realitäten nicht wahrnehmen will, sucht sie in einer Art Übersprungshandlung die Flucht nach vorne. Negiert werden mittlerweile erprobte und markteingeführte Techniken, um stattdessen Zukunftstechnologien, teilweise mit erheblichen Entwicklungsbedarf und durchaus unsicherer Zukunft, schönzureden. Das gilt etwa bei klimaneutralen Treibstoffen für Fahrzeuge und Flugzeuge. Deren technische Machbarkeit ist zwar längst in vielen Modellprojekten nachgewiesen. Wann diese Brennstoffe zu bezahlbaren Preisen auf den Massenmarkt in entsprechender Menge kommen, steht allerdings weiter in den Sternen. Kein Wunder bei diesen ziemlich aufwändigen Herstellungsprozessen (die im Übrigen teilweise auf Ökostrom basieren)!
Fossile Energien und fossiles Denken
Reiche zeigt sich skeptisch gegenüber den Erneuerbaren Energien, nicht aber in puncto Kerntechnik, ungeachtet der Tatsache, dass Atomstrom aus neuen Reaktoren ein Vielfaches von Solar-und Windstrom kostet. Außerdem müssen wir nicht nur beim Strom weg von fossiler Energie, sondern auch bei der Wärmeerzeugung und den Treibstoffen, um die deutschen CO2 Emissionen zu senken. Atomkraft bringt uns da nicht weiter. Und ein Endlager für den Atommüll der letzten Jahrzehnte ist auch die nächsten Jahrzehnte nicht in Sicht.
Ministerin Reiches hochfliegenden Pläne bei Gaskraftwerken, die erster Linie den Zweck haben, Deutschland ohne Stromimport durch zwei Wochen Dunkelflaute im Jahr zu bringen, wird die EU wohl auf das Maß zusammenstreichen, das Habeck schon plante. Statt 20 Gigawatt wird nur die Hälfte genehmigt, da sich diese Kraftwerke aufgrund kurzer Einsatzzeiten ohne staatliche Subventionierung niemals rechnen würden. Und in solchen Fällen sucht die EU Wettbewerbsverzerrungen auf dem EU-Binnenmarkt zu vermeiden. Reiche hat bislang weder der Turbo bei der Wasserstofftechnik noch den Nachbrenner beim Ausbau von großen Akkuspeichern gezündet.
Die CSU steckt 100 Millionen Euro in die Erforschung der Kernfusion, einer Technik, die in den nächsten 30 Jahren nicht anwendungsreif sein wird. Deutschland braucht aber bis 2045, also bereits in den nächsten 20 Jahren den vollständigen Umstieg auf eine klimafreundliche Energieerzeugung! Randnotiz: Wenige Monate nach dieser großspurigen Zusage muss die Bayerische Staatsregierung zugeben, dass Bayern sein ambitioniertes Klimaneutralitätsziel 2040 nicht halten kann, weil der Freistaat bei der Emissionsminderung seit 1990 deutlich langsamer als der Bund vorankam. Da wären die 100 Millionen anderswo sicher besser angelegt gewesen.
Technische Luftschlösser
Womit wir wieder bei Friedrich Merz und seinem Auftritt in Brasilien wären. Ebenfalls auffällig ist, dass die Klimapolitik, die ja den Rahmen für technische Entwicklungen setzen soll, Haushalte, Industrie und Gewerbe bei der Klimawende fördern und unterstützen soll, eine nachgeordnete Rolle spielte. Das Statement des Bundeskanzlers entspricht der Technikgläubigkeit der Union, die ganz auf eine ungewisse Zukunft und blind für das Naheliegende zu sein scheint; blind für Technik, die nicht ins ideologische Schema passt. Aus Imagegründen setzt die Partei auf irgendwelche Innovationen, die sich in Luft auflösen, wenn sie auf Tragfähigkeit abgeklopft werden. Besonders anfällig scheint da die CSU zu sin, wenn man an die Magnetschwebebahn oder an die Flugtaxis denkt (die sicher irgendwann kommen, aber ebenso sicher unsere Verkehrsproblem nicht lösen werden). Und natürlich gibt man sich in der Union gern „technologieoffen“, weil das immer gut ankommt, anstatt diejenige Technologie gezielt zu fördern und zu pushen, die den besten Kosten-Nutzen Effekt in puncto CO2-Minderung hat. (rk)
Ministerin Reiche gibt Gas
klimaseite.info, 22.07.2025
Schon kurz nach Amtsantritt macht die neue Wirtschaft- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) durch forsche Aussagen und Ansagen von sich reden. Man müsse die Erneuerbaren Energien (EE) einem Realitätscheck unterziehen. Die deutschen Klimaschutzziele seien möglicherweise überambitioniert und unrealistisch. Ins Bild passt auch die Vorgabe zum Ausbau der Gaskraftwerke auf 20 Gigawatt Leistung.
Normalstrom und Ökostrom
Strom sollte natürlich vorrangig aus erneuerbaren Quellen kommen. Auf diesem Weg hat Deutschland beachtliches erreicht. Nicht zuletzt durch die Maßnahmen der Ampelregierung betrug der Anteil von Ökostrom am Bruttostromverbrauch im vergangenen Jahr schon 55 % Prozent. Damit ist die Verwendung von Normalstrom, der Strom-Mix aus der Steckdose noch einmal ein Stück klimafreundlicher geworden. Dessen CO2-Faktor sank von 433 g/kWh (2022) auf 363 g/kWh (2024). (1) Die Ampel hat die Weichen für den weiteren Zubau von Windkraft und Photovoltaik gestellt, das Feld ist also gut vorbereitet. Viele bereits genehmigte Windkraftwerke werden in den nächsten Jahren entstehen. Auch bei der Photovoltaik sind Zuwächse zu erwarten, da die Preise bei Photovoltaikmodulen, Akkuspeichern und PV-Balkonanlagen merklich gesunken sind.
Wie viele Gaskraftwerke sollen es denn sein?
Weshalb also neue Gaskraftwerke? Der Regelungsaufwand der Netzbetreiber nimmt mit dem steigenden Anteil von fluktuierenden Stromquellen zweifellos zu, aber das Thema ist beherrschbar. Auch die Netzstabilität ist aktuell gegeben bei einem durchschnittlicher Netzausfall von nur 15 min im Jahr. Dass sie sich mit zusätzlichen Ökostromanlagen verschlechtern würde, ist Spekulation.
Auch Reiches Vorgänger Habeck ging von der Notwendigkeit einer Reserve bei der Stromerzeugung aus und gab deshalb den Startschuss für den Zubau von 12,5 Gigawatt Leistung an Gaskraftwerken. Frau Reiche erhöht jetzt auf 20 GW. Auch hier wäre ein Realitätsscheck sicher nützlich, da die Stromproduktion aus Erdgas teurer kommt als die aus großen Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Zudem sollten neue Großkraftwerke mindestens 30 Jahre laufen, damit sich die Investition lohnt. Dann aber wären bis zum Jahr 2055 immer noch fossile Großkraftwerke am Netz, obwohl Deutschland 2045 CO2-neutral sein will.
Brauchen wir neue Gaskraftwerke wegen zwei Wochen „Dunkelflaute“ im Jahr, in denen Photovoltaik und Windkraft kaum Strom produzieren und mehr aus den Nachbarländern importiert wird? Problematisch scheinen eher die Zeiten zu sein, wo Windkraft und Photovoltaik zu viel Ökostrom produzieren, und die Anlagen abgeregelt werden müssen, um das Netz nicht zu überlasten. Der Chef des Netzbetreibers Tennet, Tim Meyerjürgens, weist darauf hin, dass aus diesem Grund seit Jahren immer wieder Windräder und große Solaranlagen vom Netz genommen werden müssen („Redispatch“). Die finanziellen Verluste werden dann auf die Stromabnehmer umgelegt. Allein seit 2022 seien so über zehn Milliarden Euro „verschwendet“ worden.
Schwachpunkt Stromnetz
Ist dieses Problem an den Ökostromanlagen und ihren Betreibern festzumachen oder sollte man nicht eher die Planung, Genehmigung und Bau von neuen Trassen beschleunigen? Denn das Stromnetz ist die Schwachstelle im System. Bekanntlich geht der Ausbau seit Jahren zu langsam voran und hinkt nun dem von Ökostrom-Anlagen hinterher. Unterirdische Leitungen -von Bürgern gefordert und von der Politik beschlossen- sind wesentlich teurer in der Anschaffung und Wartung. Weil das der Politik endlich klar geworden ist, werden die Entscheidungen pro Erdtrasse zum Teil wieder rückgängig gemacht. Man setzt verstärkt wieder auf die schneller realisierbaren Freileitungen und Hochspannungsmasten.
Doch wie hoch ist der Bedarf an Gaskraftwerken wirklich? Siemens-Energy-Chef Bruch meint dazu: „Niemand kann heute serös sagen, wieviel wir im Jahr 2035 benötigen“. (2) Fest steht aber wohl inzwischen, dass in den nächsten zehn Jahren noch nicht genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, der die CO2-Bilanz der Gaskraft deutlich verbessern würde.
Mit Gas bleibt die Import-Abhängigkeit
Speziell im Stromsektor brauchen wir natürlich noch fossile Energien, solange die erneuerbaren Energien nicht den Bedarf zu jeder Zeit vollständig abdecken können und da ist Erdgas allemal besser als Kohle oder Heizöl. Bedenklicher, als die Verstromung von Erdgas in Kraftwerken, optimalerweise in Kraft-Wärme-Kopplung, ist die Verbrennung in Heizkesseln, wie sie noch millionenfach in den deutschen Kellern herumstehen. 2024 waren laut BDEW noch 50,3 % der Heizkessel Gas-Brennwertgeräte, 7,3 % Gas-Niedertemperatur und 11,9 % Ölkessel. Also laufen fast 70 % der Heizkessel in Deutschland mit fossilen Brennstoffen, schädigen das Klima und zementieren auf Jahrzehnte die Abhängigkeit von Importen. Die EU bezieht skandalöserweise immer noch Erdgas und Flüssiggas aus Russland, im 1. Quartal 2025 waren das 17 %. Größter Lieferstaat der EU aber waren die USA mit 50,7 % vor Russland und Katar mit 10,8 %. Deutschland bezieht das Erdgas überwiegend aus Norwegen, dann folgen Niederlande und Belgien mit ähnlichen Anteilen, etwas geringer ist die Einfuhrmenge von Flüssiggas. (3)
Noch zu viele Gas- und Ölheizungen
Nächstes Problem: Die Heizungen sind technisch überaltert, denn die Deutschen trennen sich nur schwer von ihren Heizkesseln. Sie müssen laufen bis ultimo, gern auch mal 30 Jahre, selbst wenn der Betrieb wegen Ineffizienz Jahr für Jahr unnötig Geld kostet. Die schlechte Presse zu Habecks „Heizungsgesetz“ und die Unsicherheit über den Kurs der neuen Bundesregierung hat der Heizungsbranche 2024 einen enormen Umsatzeinbruch um über 45 % gegenüber dem Vorjahr beschert. Der Kesselaustausch stockt und die Wende von den fossilen zu den erneuerbaren Energien ist auf dem Wärmesektor, bei den Heizungen, noch nicht geglückt. Auch im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr klimaschädliche Gasheizungen verkauft als klimafreundliche Wärmepumpen.
Dabei ist die Zeit des günstigen Erdgases ist vorbei. Flüssiggas (LNG) aus den USA, das inzwischen über die Hälfte der deutschen LNG-Importe ausmacht, wird mit erheblichem Aufwand und oft unter umweltschädigenden Bedingungen dem Untergrund abgerungen, verflüssigt und per Tanker nach Europa transportiert. Es versteht von selbst, dass dieser massive Einsatz an Material, Chemie und Energie nicht nur den Preis, sondern auch den CO2-Faktor des LNG gegenüber Erdgas per Pipeline in die Höhe treibt.
Zweifellos haben uns die Flüssiggasimporte nach dem Aus für Nordstream im Sommer 2022 über zwei Winter gerettet. Dazu musste in aller Eile eine Infrastruktur mit LNG-Terminals aufgebaut werden. Ministerin Reiche zollt Ex-Minister Habeck für diese Leistung höchsten Respekt. Bei den Erneuerbaren Energien ist sie allerdings anderer Auffassung, denn das entsprechende Ausbauziel hält sie unrealistisch. (2)
Erdgas contra Erneuerbare
Ministerin Reiche setzt bei der Stromerzeugung wohl eher auf Erdgas, plädiert auch für den Ausbau inländischen Gas-Förderung, einschließlich der Nordsee (Borkum), weil sie ohnehin an der Sinnhaftigkeit der deutschen Klimaschutzziele zweifelt. Bislang war aber die Energiewirtschaft wegen der Abschaltung von unwirtschaftlichen Kohlekraftwerken und dem Zuwachs an Ökostrom bei den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes im grünen Bereich und rechnerisch imstande, die Defizite anderer Emissionssektoren auszugleichen. Aber das muss nicht so bleiben, wenn jetzt verstärkt Gaskraft ins Spiel kommen sollte. Die Bundesregierung wäre allerdings gut beraten, den Kurs der Ampel bei den EE fortzusetzen. Schon, weil von Seiten der EU ebenfalls Leitplanken bei der Energie gibt, die über den Strom hinaus den gesamten Endenergieverbrauch betreffen. Denn nach den EU-Richtlinien RED I und RED II sollen die Erneuerbaren bis 2030 42,5 % des gesamten Endenergieverbrauchs decken. Deutschland peilt 41,0 % an. Das ist in fünf Jahren kaum zu schaffen, denn aktuell steht Deutschland ungefähr bei der Hälfte. (4) Haupthindernis auf diesem Weg ist die fossile Abhängigkeit der Emissionssektoren Verkehr, Gebäude und Industrie. Speziell im Stromsektor ist die Zielvorgabe aber bereits übererfüllt. (rk)
Quellen:
(1) Informationsblatt CO2-Faktoren, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn, 01.08.2024
(2) „Das europäische Stromnetz ist die größte und komplexeste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat“, 11. 07.2025, SZ, Interview von Bauchmüller/Salavati mit Tim Meyerjürgens
(3) Bundesamt für Statistik www.statista.de
(4) „Die Anti-Habeck“, Becker/Müller-Arnold, Der Spiegel, 11.07.2025
(5) „CO2-Emissionen pro Kilowattstunde 2024 gesunken“, Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de, 09.04.2025
(6) „Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch“, Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de
Das Schmelzen der Gletscher und die Folgen
klimaseite.info, 05.05.2025
Die Vereinten Nationen haben 2025 zum internationalen Jahr der Gletscher erklärt, aber gleichzeitig schrumpfen die mächtigen Eisriesen, weil ihnen die Erderwärmung immer stärker zusetzt. (1) Laut der Weltwetterorganisation WMO zeigten die vergangenen drei Jahre den größten Verlust an Gletschermasse, der jemals festzustellen war. Doch dieser beunruhigende Trend zeichnet sich schon länger ab. Seit 1975 haben die Gletscher nach Erkenntnis von Glaziologen weltweit etwa 9.000 Milliarden Tonnen Eis verloren, was einen Eisblock mit der Fläche Deutschlands und einer Dicke von 25 Metern entspricht. Fachleute erwarten, dass Österreichs Gletscher bei 2,7 Grad Celsius plus, was etwa dem aktuellen Trend entspräche, bis 2075 verschwunden sind. (4)
Ähnlich wie das Sterben der Korallenriffe ist die Gletscherschmelze kein linearer Prozess und er läuft auch nicht in allen Regionen gleich ab, sondern hängt stark von der Höhenlage, von Jahreszeiten und Temperatur ab. Gletscher wachsen bei tiefen Temperaturen, wenn die Schneeschicht auf dem Eis durch die Last der Schneeschichten darüber verdichtet wird. Die Gletscher tauen an der tieferliegenden Gletscherzunge stärker, können aber am Scheitelpunkt stabil bleiben oder zwischenzeitlich sogar wachsen. In diesem Fällen entsteht der Eindruck, dass der Gletscher aus den wärmeren Gefilden flüchtet, sich in die Höhe zurückzieht. Nur bei Neuschnee präsentieren sich die Gletscher ganz in Weiß, sonst eher in Grau aufgrund von Staub- und Rußablagerungen. Dieser Schmutz, der von Staubverwehungen, von Waldbränden und aus der Verbrennung fossiler Energieträger stammt, reduziert auch die Rückstrahlung der Gletscher, mit der Folge einer schnelleren Erwärmung der Oberfläche durch die Sonne. (5)
Der Schwund an Gletschereis ist ein globales Phänomen und betrifft natürlich auch die Gletscher in Mitteleuropa, die 39 % ihrer Masse zwischen 2000 und 2023 verloren haben. Der bekannte Schneeferner an der Zugspitze, Deutschlands größter Gletscher, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Der südliche Teil ist 2023 verschwunden, den nördlichen Teil wird dieses Schicksal in 10 oder 20 Jahre ereilen. Fotografisch gut dokumentiert ist das im „Gletscherarchiv“. (2)
Das Sterben der Gletscher in den Bergen hat Folgen, die weit ins Tiefland reichen. Im Vorfeld der Gletscher werden dadurch große Schuttareale freigelegt, Gletscherseen wachsen an. Beides kann zu Bedrohung für Siedlungen im Tal werden. Die Gefahr von Murabgängen und Felsstürzen wird noch verstärkt durch den Rückgang der Permafrost-Eisschicht, die Erdreich und Gestein wie Zement zusammenhält. Gletscherwasser speist Bäche, die in Flüsse münden. Wenn die Pegel dauerhaft sinken, ist Fauna und Flora in den Fließgewässern und an ihren Rändern betroffen. Die Biodiversität ändert sich gravierend. Wenn das Eis schmilzt und die Temperaturen steigen, wandern wärmeliebende Pflanzen und Tiere nach oben, wo sie manches Mal auf nackte Felsen stoßen. Gleichzeitig sind auch kaltwasserliebende Tiere in Flüssen betroffen, wenn sich der Zufluss von kaltem Schmelzwasser verringert.
Es gibt aber noch einen Grund, weshalb uns die Gletscherschmelze nicht egal sein kann: Die Gletscher stellen ein enormes Trinkwasserreservoir dar, das peu a peu buchstäblich den Bach hinunter geht. In einem Jahr geht laut Experten so viel Gletschereis verloren, wie es dem Wasserverbrauch der Weltbevölkerung innerhalb von 30 Jahren entspräche, wenn man von drei Litern pro Tag und Person ausgeht: Trinkwasser und Süßwasser, essenziell für Mensch und Natur.
Die Lebensgrundlage von 2 Mrd. Menschen ist durch die Gletscherschmelze bedroht, warnt die UNESCO in ihrem Weltwasserbericht. Die Gletscher der Alpen, des Himalaya, der Anden, Neuseelands etc. stellen wertvolle Wasserspeicher für viele Länder und Regionen dar. Ein Teil des Schmelzwassers kann natürlich aufgefangen und genutzt werden, als Trinkwasser, für die Landwirtschaft, zur Stromerzeugung per Wasserkraft oder zur Kühlung von Kraftwerken, bevor sich das Süßwasser mit dem Salzwasser der Ozeane vereinigt.
Die Gletscher tragen damit zum Anstieg des Meeresspiegels bei, etwa 18 mm seit der Jahrtausendwende. Seither verlieren sie global jedes Jahr durchschnittlich etwa 273 Mrd. Tonnen Eis und die Abbau-Geschwindigkeit nimmt zu. (3) Apropos Meeresspiegel: Da auch die Eisschilde der Antarktis und auf Grönland schmelzen, droht bei fortgesetzter Erderwärmung nach 2100 ein weitaus größerer Anstieg des Meeresspiegels von geschätzt 50 Metern bis über 60 m. Wie sich Küstenstädte und küstennahe, tiefliegende Regionen dann schützen können, steht in den Sternen. Zur raschen Reduzierung der Treibhausgasemissionen gibt es deshalb keine Alternative. Jedes Zehntel Grad Erderwärmung weniger zählt. (rk)
Quellen:
(1) „Diese Eisriesen zerrinnen“, Heber/Menze, Der Spiegel online, 27.03.2025
(2) Website „Gletscherarchiv“, www.gletscherarchiv.de, Gesellschaft für Ökologische Forschung, München
(3) „Forscher nennt Gletscherschwund Überlebensfrage für die Menschheit“, Der Spiegel online, 20.03.2025
(4) „Österreichs Gletscher tauen in den nächsten Jahrzehnten weg“, Der Spiegel online, 10.04.2025
(5) „Weltwasserbericht 2025 der Vereinten Nationen. Gebirge und Gletscher als Wasserspeicher“, UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP), Perugia, 22.03.2025
Der Stand der Dinge beim Klimawandel
klimaseite.info, 02.04.2025
Vom Klima zum Extremwetter
Wer nicht nur die Wetterberichte der „Tagesschau“ anschaut, sondern auch einen Blick auf die Website wirft, konnte kürzlich lesen: „Extreme Wettereignisse, wie tropische Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und andere Gefahren zwangen vergangenes Jahr so viele Menschen zur Flucht wie seit 16 Jahren nicht. Gebirgsgletscher, die ein wichtiges Trinkwasserreservoir darstellen, schmolzen in den vergangenen drei Jahren stärker als je zuvor.“ (1)
Der letzte Bericht der Weltwetterorganisation WMO zeigt ein stilles Drama: den fortschreitenden Klimawandel mit teilweise unumkehrbaren Folgen. Aufgrund der Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre schreit die Erderwärmung voran. Erde und Menschheit sind auf Rekordjagd. Die Konzentration von Kohlendioxid, Methan und Lachgas ist hoch wie nie seit 800.000 Jahren. Jedes der letzten zehn Jahre seit 2015 zählt zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Jahr 2024 wurde mit durchschnittlichen 1,55 Grad plus erstmals die untere Zielmarke der UN-Klimakonferenz von Paris (2015) überschritten. Dieses Klimaschutzziel ist zwar theoretisch noch erreichbar, dies wird aber angesichts des Wachstums der globalen Emissionen zunehmend unrealistisch. Stand heute ist unklar, ob der Peak bei den Treibhausgasen bereits erreicht ist; erst recht, ob die für das 1,5-Grad-Ziel notwendige Minderung um minus 42 % bis 2030 klappt.
Wie geht es weiter? Der Ausblick bis 2100
Das Umweltbundesamt gibt auf Basis der Klimaforschung und den Berichten des Weltklimarats IPCC folgende Prognosen (2) für die Entwicklung bis Ende des Jahrhunderts ab:
– Die Fortsetzung der aktuellen, wenig ambitionierten Klimapolitik der Nationalstaaten könnte bis 2100 zu einer Erderwärmung von 3,2 Grad Celsius gegenüber dem 18. Jahrhundert führen.
– Der Meeresspiegel wird deshalb und mit zunehmender Geschwindigkeit anstiegen, zum einen durch die thermische Ausdehnung, seit 2000 in der Hauptsache aber durch das Abschmelzen der Gletscher, sowie der Eisschilde der Antarktis und auf Grönland.
– Da sich Landmassen rascher als die Ozeane erwärmen, dürfte dies für Europa – je nach Region in unterschiedlicher Intensität – ebenfalls zutreffen. „Die durchschnittliche Jahrestemperatur über den europäischen Landflächen war im letzten Jahrzehnt 2,12 bis 2,19 °C höher als in vorindustrieller Zeit.“ Europa erwärmt sich also schneller als der globale Durchschnitt.“
– Extremwetterereignisse werden zunehmen. „Hitzewellen werden häufiger, intensiver und dauern länger.“ Das Gleich gilt für Dürreperioden. Vor allem mediterrane Regionen in Südeuropa seien dürften öfter von Wüstenbildung („Desertifikation“), Wasserknappheit und Waldbränden betroffen sein. c
– Die jährlichen Niederschläge nähmen in Nordeuropa zu und in Südeuropa ab. Für Mitteleuropa dürften die Frost- und Schneetage im Winter weniger, die Niederschlagsmenge zu dieser Jahreszeit aber mehr werden. Auch die sintflutartigen „Starkregenereignisse“ werden sich in Europa voraussichtlich häufen.
Gleichzeitig bringt das Umweltbundesamt sehr deutlich zum Ausdruck, dass die tatsächlich durchgeführten Klimaschutznahmen, die zugesagten Beiträge und die Strategien nicht annähernd für das 1,5 Grad-Ziel ausreichen. Die deutsche Behörde kann sich dabei auf den Bericht des UN- Umweltprogramms berufen, den „Emissions Gap Report 2024.“ Dort ist neben dem Stand der Treibhausgasemissionen – 57 Gigatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2023 – auch die Kluft zum 1,5 Grad-Ziel dargestellt. Sie bleibt bestehen, selbst wenn der Zusagen der Nationalstaaten im Gefolge des UN-Klimaabkommens von Paris 2015 eingehalten werden. (5)
Keine Insel der Seligen
Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass auch Deutschland vom Klimawandel nicht verschont bleibt. Ausmaß und Gefahren werden aber immer noch unterschätzt mit der Folge, dass zu wenig für Klimaschutz und Klimaanpassung getan wird. Die wichtigsten Themen der Europwahl 2024 und der Bundestagswahl 2025 waren weder Klimaschutz, noch Klimaanpassung, sondern Wirtschaft und Migration. Die „Flüchtlingskrise“ schien wichtiger als die Klimakrise. Das Makabere dabei: Die weltweiten Migrationsströme werden parallel zur Erderwärmung zunehmen und das auch mit deutscher Hilfe, denn die Klimagas-Emissionen der Deutschen liegen etwa doppelt so hoch wie im weltweiten Pro-Kopf-Durchschnitt.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) musste kürzlich seine früheren Angaben hinsichtlich des Anstiegs der Durchschnittstemperaturen hierzulande seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 nach oben korrigieren und geht jetzt von 2,5 Grad plus bis 2024 aus, was etwa ein Grad Celsius mehr als der globale Mittelwert bedeutet. 2024 lag die Jahresmitteltemperatur in Deutschland mit 10,9 Grad Celsius 0,3 Grad über dem Vorjahr. Auch das Tempo der Erwärmung nehme zu, ebenso wie die negativen Auswirkungen. Allein die Extremwetter des letzten Jahres hätten die Versicherer 5,5 Mrd. Euro gekostet. (6) Die vom DWD veröffentlichte Grafik (7) zeigt, dass die Temperaturabweichungen nach oben immer größer, die roten Balken immer länger werden.
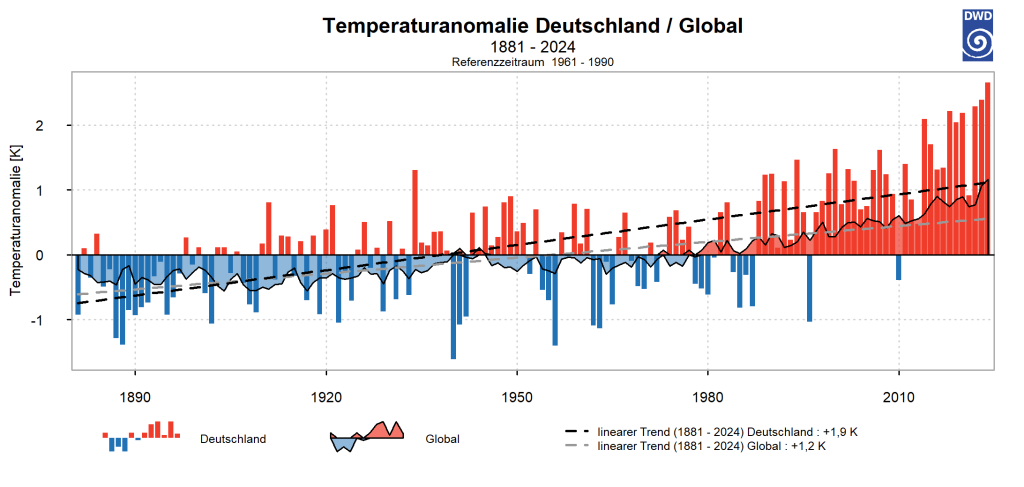
Wird aus der Erde ein „Wüstenplanet“?
Andere Studien zeigen, dass sich der Trend zur Wüstenbildung längst nicht auf bestimmte Regionen Europas beschränkt, sondern global zu beobachten ist. Die Landmassen der Erde verlieren an Bodenfeuchte, Grundwasser schwindet und Oberflächengewässer schrumpfen. Mindestens seit der Jahrtausendwende, wahrscheinlich schon seit Ende der 70er Jahre werden die Kontinente trockener. Über Flüsse, Verdunstung und Regen gelangt immer mehr Wasser in die Weltmeere und trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei, der inzwischen mit über 4,7 mm pro Jahr voranschreitet. (4) Aus Süßwasser wird Salzwasser mit negativen Folgen für die Gewinnung von Trinkwasser. Die Wasserumverteilung verändert auch die Massenverteilung auf der gesamten Erde mit dem Effekt, dass ihre Unwucht bei der Drehung zunimmt, sie stärker um die Erdachse herum „eiert“. Per Satellit lässt sich diese „Polschwankung“ feststellen und messen. (3) Die Menschen bekommen diese Abweichung nicht mit, wohl aber die Auswirkungen der Erderwärmung mitsamt der Ausbreitung von Bodentrockenheit und Dürreperioden.
Quellen:
(1) „Folgen des Klimawandels teils unumkehrbar“, tagesschau.de, 19.03.2025
(2) „Zu erwartende Klimaänderungen bis 2100“, Umweltbundesamt, 29.01.2025
(3) „Der Wüstenplanet“, Süddeutsche Zeitung, Benjamin von Brackel, 27.03.2025
(4) „WMO report documents spiralling weather and climate impacts”, WMO, 19.03.2025
(5) “Emissions Gap Report 2024”, UN Environment Programme, Nairobi, 24.10.2024
(6) “DWD warnt: Erwärmung beschleunigt sich in Deutschland“, Süddeutsche Zeitung, von Eichhorn, 01.04.2025
(7) Klimapressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dwd.de, 01.04.2025
Auch in der Arktis wird es wärmer – mit Folgen
klimaseite.info, 11.02.2025
Vom Zugspitzgletscher wird in einigen Jahren nicht mehr übrig sein. Das gleiche Schicksal werden Alpengletscher über kurz oder lang erleiden. Weil sich die nördliche Hemisphäre und vor allem die Arktis überdurchschnittlich stark erwärmt, hat das negative Auswirkungen auf das Meereseis, das Eis an Land, etwa auf Grönland und die ganzjährig gefrorenen Böden der Permafrost-Zone: Eis schmilzt, Böden tauen auf und Treibhausgase werden frei. Als „Arktis“ wird die Region nördlich des Polarkreises, des 66. Breitengrades, bezeichnet, der Kanada, Grönland, Skandinavien und Sibirien durchschneidet. Hier steigen die Temperaturen fast viermal schneller als im globalen Durchschnitt.
Es taut
Jetzt hat ein Forscherteam nach einem Bericht in Science die Entwicklung, bis Ende des Jahrhunderts simuliert unter der Annahme, dass die Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit ein Plus von 2,7 Grad bringt, was ja den aktuellen Trend wiedergibt. Ergebnis: Die Arktis wäre monatelang eisfrei. Schon heute häufen sich die Temperaturanomalien. Ende Januar/Anfang Februar dieses Jahres wichen die Temperaturen „in weiten Teil der Arktis um mehr als 20 Grad von den typischen Werten dieser Jahreszeit ab.“ (1) Stellenweise lagen sie nur ein Grad unter dem Gefrierpunkt. Dirk Notz von der Universität Hamburg kommentierte, eine Hitzewelle dieser Größenordnung sei „extrem ungewöhnlich“. (1) In der Arktis steigen die Temperaturen fast viermal schneller als im globalen Durchschnitt. Die Sonne scheint im hohen Norden Tag und Nacht, aber Eis und Schnee reflektieren einen Teil der Solarstrahlung. Dieser Effekt nimmt natürlich ab, wenn die Reflexionsflächen schrumpfen. An Land tauen die Permafrostböden allmählich auf, so dass bislang tiefgefrorene Pflanzenreste zu verrotten beginnen. Rund ein Drittel der arktischen Landfläche ist inzwischen eine Quelle für CO2 und Methan.
Die Pegel steigen
Die Schmelze des Meereises lässt den Meeresspiegel nicht ansteigen, wohl aber das Abtauen des Festlandeises auf Grönland. Dieser kilometerdicke Eisschild schmilzt immer schneller, er verliert die gigantische Menge von 30 Mio. Tonnen Eis pro Stunde (2) Nach dem derzeitigen Trend der Erderwärmung von plus 2,7 Grad Celsius plus könnte die kilometerdicke Eisschicht tatsächlich komplett abschmelzen. In diesem Jahrhundert ist das nicht zu erwarten, bis 2100 würde das Meer allerdings durch dieses Schmelzwasser um 20 cm ansteigen. Insgesamt ist mit der thermischen Ausdehnung des Meerwassers, das sich ja ebenfalls erwärmt, und der gerade anlaufenden Schmelzvorgänge in der Antarktis in diesem Jahrhundert ein Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 bis 1,9 Meter möglich. Richtig dick kommt es dann erst in den nächsten Jahrhunderten, falls die menschgemachte Erderwärmung weiter zunimmt und das Festlandeis in beide Polarregionen zunehmend schwindet. Denn bei einem Anstieg des Meeresspiegels von über sechzig Meter gäbe es für die meisten Küstenstädte keine Rettung mehr.
Die Klimaänderungen in der Arktis und speziell auf Grönland können uns nicht kalt lassen, denn die Auswirkungen betreffen auch Europa. Neben den hefigeren Sturmfluten infolge des steigenden Meeresspiegels ist auch zu befürchten, dass der Golfstrom, die „Warmwasserheizung“ Europas gestört wird. Durch das Abschmelzen des Eisschildes auf Grönland fließt Süßwasser in erheblichen Mengen ins Meer, das leichter ist als das salzhaltige Meereswasser. Das Absinken der oberen Schicht des Golfstroms könnte an dieser Stelle gehemmt werden, so die Befürchtung einiger Klimaforscher. Damit wäre eine der Pumpen tangiert, die den Golfstrom am Laufen halten. (rk)
Quellen:
(1) „Extreme Hitze in der Arktis – und eine düstere Prognose“, von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 06.02.2025
(2) „Wenn die Arktis schmilzt. Wie extrem ist das Wetter, Sven Plöger?“, Das Erste, 03.02.2025
Die deutschen Vorbehalte gegen E-Autos
klimaseite.info, 06.02.2025
Längst ist klar, dass der Klimaschutz das Aus für Verbrennerautos -egal ob Diesel oder Benziner- erfordert. Viele Länder, vor allem die skandinavischen, aber auch China haben das längst erkannt. In Deutschland setzt sich die Tatsache allerdings nur sehr zögerlich in den Köpfen fest. Die Zahl der bis zum 1.1.2024 zugelassenen, reinen Elektroautos 1,4 Mio. von insgesamt 49,1 Mio. Pkw und der jährlichen Neuzulassungen zeigen das mit aller Deutlichkeit. Nur rund 380.600 reine Elektro-Pkw wurden letztes Jahr neu zugelassen, ein Viertel weniger als im Vorjahr. (1) Die Bundesregierung wollte 15 Mio. reine E-Fahrzeugen im Jahr 2030 auf den Straßen haben. Das dürfte schwierig werden, denn aktuell sind gerade mal 10 Prozent unterwegs. Statt zu sinken, stieg der durchschnittliche CO2-Ausstoß auf 119,8 g/ km. (4) Die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs läuft schleppend hierzulande. Was sind die Gründe dafür?
Gerüchte und Mythen
Beim Aufkommen der E-Autos galt die Ökobilanz der Batterien als Schwachstelle. Dieser Kritikpunkt hat sich insofern erledigt, als die Lithiumionentechnik heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, da Handys, Notebooks und alle möglichen Geräte damit ausgestattet sind. Speziell bei der Treibhausgasbilanz über den gesamten Lebenszyklus schneiden E-Autos nach einer Studie des Umweltbundesamts besser ab als vergleichbare Verbrenner. 2020 verursachte ein durchschnittlicher Kompaktwagen mit 55 kWh-Batteriekapazität gegenüber einem Benziner 41% weniger CO2-Äquivalente. (2)
Lange war zu hören, es gäbe zu wenig Ladepunkte. Das ist Schnee von gestern, inzwischen gibt es fast zu viele. Auf 15.000 konventionelle Tankstellen kommen mehr als 154.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge. Selbst wenn man die einzelnen Zapfsäulen für Verbrennerautos miteinbezieht, dürften E-Autos mehr Tankmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Vor allem die Stromtankstellen auf dem Land sind zu wenig frequentiert, als dass sie auf Dauer wirtschaftlich betrieben werden könnten. Die Mehrzahl der Ladepunkte weist zudem eine Leistung von über 22 kW. Es sind sogenannte „Schnellladepunkte“ mit Ladezeiten von rund einer halben Stunde. Die EU-Vorgaben für die Netzdichte sind in Deutschland übererfüllt, das alte Ziel der Bundesregierung von einer Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030 gilt mittlerweile als „technisch überholt“. (3) Auf Firmengelände oder auf Privatgrund („Wallboxen“) gibt es bereits über eine Million Ladestellen. Sie bieten die billigste Art, Strom zu tanken, denn anderenfalls ist mit 11 Euro Stromkosten pro 100 km zu rechnen, was aber immer noch deutlich günstiger ist als die Kosten für Benzin oder Diesel auf diese Entfernung.
Reicht die Reichweite?
Keine Tankstelle zu finden, war lange ein Grund für die „Reichweitenangst“, die Batteriekapazität ein anderer. Aber bei der Entwicklung der Lithiumionen-Akkus hat sich viel getan in den letzten Jahren. Beim ADAC „Ecotest“ kamen die E-Autos im Durchschnitt auf fast 400 km Reichweite, inzwischen knacken aber viele bereits die 500-km-Marke und die Spitzenreiter liegen sogar über 600 Kilometer. Auch dieser Vorbehalt ist also unbegründet. Bleibt das Problem der höheren Anschaffungskosten im Verhältnis zu gleichwertigen Verbrennern. Die staatliche Kaufprämie konnte diese Lücke teilweise schließen, nach dem Wegfall brach der Absatz der Stromer in Deutschland ein. Allerdings ist das Problem speziell beim Hersteller VW durchaus hausgemacht, denn andere Autokonzerne bieten vergleichbare Fahrzeuge günstiger an. Selbst beim Sondermodell „VW Goal“ bleibt die elektrische Variante trotz Kaufprämie des Herstellers über 30.000 Euro und liegt zudem ein paar Hundert Euro über der Verbrenner-Version. Renault, Citroen und Leapmotor verkaufen hingegen elektrische Modelle für 25.000 Euro oder weniger.
Die Innovationen sind bereits auf dem Markt
Die Politiker und Parteien, die das Verbrenner-Aus kippen oder hinauszögern wollen, beweisen damit, dass ihr Gerede von der „Technologieoffenheit“ nicht ernst zu nehmen ist und oft das Gegenteil zur vielzitierten Innovationsbereitschaft vorliegt. Konservative Politiker können sich dabei natürlich auf das Verbraucherverhalten und die Kaufgewohnheiten der Deutschen berufen. Ob beim Kauf von Autos oder von Heizungen, wo mit der elektrischen Wärmepumpe ebenfalls eine bewährte und klimafreundliche Technik zur Verfügung steht: Die Deutschen tun sich schwer mit dem fälligen Ausstieg aus den fossilen Energien. Dieser Strukturkonservatismus erschwert den Wandel zur E-Mobilität, hat die deutsche Autoindustrie im globalen Wettbewerb zurückgeworfen und Markanteile gekostet. 2015 hätte der Dieselskandal, die Trickserei und der Betrug rund um die zu hohen Stickoxidwerte (NOx), schon das Aus für den Diesel bedeuten können, ja: müssen. Es kam anders, wie wir wissen. Diesel-Pkw werden immer noch gekauft, Millionen Fahrzeuge mit veralteter Abgastechnik sind auf den Straßen unterwegs und in manchen Städten werden die NOx-Grenzwerte überschritten. Und das zehn Jahr nach dem Aufkommen des Skandals, aus dem die damalige Bundesregierung (Union/SPD) keine Konsequenzen zog, stattdessen die Bürger in den krankmachenden Abgasen stehen ließ.
Verkehrswende lässt auf sich warten
Bei den Emissionssektoren Verkehrs und Gebäude wurde das Limit des Klimaschutzgesetzes in den letzten Jahren mehrfach überschritten. Besserung brächte In beiden Bereichen eine Elektrifizierung von Wärmeerzeugung und Antrieb. Die Ablösung von fossilen Kraft- und Brennstoffen durch Strom macht auch deshalb Sinn, weil der Anteil des klimafreundlichen Ökostroms im deutschen Strom-Mix stetig gewachsen ist und aktuell bei 59 % der Nettostromerzeugung liegt. Zweifellos sind die Klimaschutzziele im Verkehr nur mit Elektromobilität zu erreichen, wie das Umweltbundesamt bereits im Jahr 2016 festgestellt hat, wobei der Antriebswechsel allein nicht ausreichen wird. Zusätzlich braucht es Verkehrsvermeidung und die Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Tonnenschwere Plug-in-Hybride sind keine Alternative zu reinen E-Autos. Auch die Hoffnung auf Verbrenner mit E-Fuels ist trügerisch, da diese Fahrzeuge aufgrund des aufwändig hergestellten Treibstoffs im Betrieb für die meisten Autofahrer zu teuer sein werden. Die Herstellung von Sprit aus CO2 und Wasserstoff funktioniert zwar, wird aber den Pkw-Verbrennungsmotor aller Voraussicht auch nicht retten können. Warum auch, wenn der Elektromotor bei der Energieeffizienz weit vorne liegt?
Quellen:
(1) Zahlen des Kraftfahrtbundesamts, www.kba.de
(2) Website des Umweltbundesamts, www.umweltbundesamt.de; siehe auch: „Analyse der Umweltbilanz von Kfz mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr“, Berlin 2024
(3) „Bye-bye, Reichweitenangst“, Grigat/Haitsch/Kissel, Der Spiegel, 29.01.2025
(4) „Pkw-Zulassungen 2024: E-Auto-Boom jäh beendet“, www.adac.de, 14.01.2025
Überlastete Natur: Wenn CO2-Senken zu Quellen werden
klimaseite.info, 02.02.2025
Im Herbst letzten Jahres dürfte eine Nachricht aus der Klimaforschung viele überrascht hacben: Der deutsche Wald hat in den letzten Jahren mehr Kohlendioxid freigesetzt als gebunden, ist also von einer Senke zu einer Quelle geworden. Und das schon seit 2017. Bundesminister Cem Özdemir hatte diese schlechte Nachricht im Bericht zur Bundeswaldinventur „Der Wald in Deutschland“ publik gemacht. Obwohl die Waldfläche etwas zunahm, schrumpfte die Masse lebender Bäume, der Totholzanteil stieg. Ein Grund ist der Klimawandel. Langanhaltende Trockenheit, wie Deutschland sie seit 2017 mehrfach erlebt hat, schwächt die Bäume, macht sie anfälliger für Schädlinge und Waldbrände. (1)
Eine ähnliche Entwicklung ist weltweit feststellbar. Ob am Amazonas, in Kanada oder aktuell in der Nähe von Los Angeles: Verheerende Waldbrände bedrohen Leben, richten enorme Schäden an und setzen auf einen Schlag große Mengen CO2 frei. Das hat Folgen für den Klimaschutz, denn Bäume und Pflanzen an Land und im Meer nehmen etwa die Hälfte des Kohlendioxids auf, das der Mensch durch das Verfeuern von fossilen Kraft- und Brennstoffen, von Erdgas, Kerosin, Benzin, Diesel, Heizöl, Kohle und Brennholz tagtäglich in die Atmosphäre schickt. Wenn die Wälder leiden, schwindet natürlich auch ihre Speicherfähigkeit für das Klimagas. Die CO2-Konzentration in der Luft, die seit Jahrzehnten an vielen Stellen auf der Erde gemessen wird, etwa auf der Zugspitze oder am Mauna Loa Observatorium auf Hawaii, zeigt dementsprechend auch jahreszeitliche Schwankungen analog zum globalen Wachstum der Vegetation. (2)
In manchen Jahren nehmen die Landökosysteme relativ wenig CO2 auf. 2023 waren es nur 0,44 Mrd. Tonnen Kohlenstoff, der niedrigste Wert seit 20 Jahren, so Forscher der Universität Paris-Saclay. (3) Trotzdem wäre übertrieben, von einem Kollaps der Kohlenstoffsenken zu sprechen, denn die Natur stellt immer wieder ihre Fähigkeit zur Regeneration unter Beweis. Und der „Global Carbon Budget Report 2024“ kommt zu einem etwas besseren Ergebnis hinsichtlich der CO2-Speicherung von Landsystemen im Jahr 2023, nämlich 2,3 Mrd. Tonnen Kohlendioxid. Das wären allerdings auch nur magere sechs Prozent der global emittierten 37,4 Mrd. Tonnen. (4) Die Klimaforscher kommen überwiegend zu dem Schluss, dass „der Klimawandel die Landökosysteme inzwischen stärker belastet“. Das gilt nicht nur für die Tropen oder das Amazonasbecken, sondern auch für die Wälder auf der nördlichen Halbkugel, in Sibirien und Kanada.
Auch die Waldbrände rund um Los Angeles, immer wieder angefacht durch die Sant-Ana-Fallwinde, lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückführen, wie das Forscherteam des Imperial College London festgestellt hat. (5) Denn die ganze Region blickt auf eine ungewöhnlich Trockenperiode zurück. Da genügte schon ein Funke, möglicherweise von einer Stromleitung, um dürres Gras, Totholz und ausgetrocknete Bäume zu entflammen.
Quellen:
(1) „Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der 4. Bundeswaldinventur“, BMEL, Bonn, Oktober 2024
(2) CO2-Konzentration vom Dez. 2024, gemessen am Mauna Loa Observatorium, Website www.gml.noaa.gov
(3) „Schlägt die Natur zurück?“, von Brackel, Süddeutsche Zeitung, 27.11.2024
(4) Internationale Energieagentur, www.ieaa.org
(5) „Klimawandel hat Feuer verstärkt“, von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 30.01.2025
Wo steht die Welt beim Klimaschutz?
klimaseite.info, 17.11.2024
Um die überlebenswichtige Minderung der Treibhausgase ist es gar nicht gut bestellt, um es gleich vorneweg zu sagen. Aber in diesem November, während Spanien zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen unter Starkregen und Überschwemmungen leidet, besteht wieder einmal die Chance, das Ruder herumzureißen. Denn die Staatengemeinschaft trifft sich wie jedes Jahr zur UN-Klimakonferenz (COP), diesmal in Baku, Aserbeidschan, einem autokratisch regierten Ölförderland. Politische Beobachter hegen ob dieser schlechten Rahmenbedingungen und nach den Erfahrungen der COP 28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wenig Hoffnung auf Besserung bei dieser COP 29, geschweige auf einen Durchbruch wie bei der COP 21 in Paris. Bundeskanzler Scholz, ohnehin ein Regierungschef auf Abruf, bleibt der Veranstaltung fern.
Und wie jedes Jahr ziehen UN-Institutionen, das Umweltpragramm UNEP und die Weltwetterorganisation WMO, kurz vor der UN-Klimakonferenz Bilanz zum Stand der Treibhausgasemissionen und der Erderwärmung, ergänzend zu den Studien der Klimaforscher, die in den letzten Monaten neu erschienen sind. (1) Die Vereinten Nationen und UN-Generalsekretär Guterres verbinden diese Veröffentlichungen inzwischen mit Warnungen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen, gefolgt von der fast flehentlichen Ermahnung, wenigstens dieses Mal reale Fortschritte zu erzielen. „No more hot air, please!“, so die Überschrift des „Emissions Gap Report 2024“ der UNEP. (2)
Neuer Temperaturrekord
Diesem Bericht über die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zu entnehmen, dass letztes Jahr so hohe Mengen an Treibhausgasen wie nie zuvor in die Atmosphäre geschickt wurden, nämlich 57,1 Milliarden Tonnen (bzw. Gigatonnen) CO2-Äquivalente in Form von Kohlendioxid, Lachgas und Methan. Die weltweiten Emissionen steigen also weiter. Inzwischen hat das Klimagas CO2 eine Konzentration von 422,5 parts per million erreicht; 52 Prozent über dem vorindustriellen Level. Die Klimagase steigern den Treibhauseffekt und der treibt die Erderwärmung an. Laut WMO lag die globale Mitteltemperatur 2023 bei einem Plus von 1,45 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden 2024 die 1,5 Grad Celsius plus ganzjährig überschritten. Heuer spielt sicher auch El Nino eine Rolle, aber zweifellos geht die menschgemachte Erderwärmung rasant weiter. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müsste der Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 42 Prozent gesenkt werden, mithin innerhalb von sechs Jahren. Nicht wenige, so auch der Klimaforscher Mojib Latif, halten das für illusorisch. Nach der UNEP steuern wir mit den selbstgesteckten Zielen im weltweiten Durchschnitt bereits auf plus 1,9 Grad Celsius zu. Schon das Ambitionsniveau ist also zu niedrig. Werden keine zielführenden Maßnahmen oder Gesetze beschlossen oder nicht umgesetzt, könnte die Welt sich um plus 3,1 Grad Celsius erwärmen: ein Horror-Szenario!
Vielen Menschen, Bürgern, Managern und Politikern scheint der Ernst der Lage nicht bewusst zu sein. Umsetzungsdefizite sind häufig zu finden, auch in der EU, wenn man tiefer in die Klimapolitik einsteigt und die Klimaschutzprogramme unter die Lupe nimmt. Mal fehlt es am Personal, mal am Geld oder schlicht am politischen Willen. Nicht nur in Deutschland ist die Mär, Klimaschutz würde rein auf Basis von Aufklärung, Angeboten, Fördergeldern und Freiwilligkeit, also ohne höheren Energie- und CO2-Preis, ohne Verbote und Gesetze, weit verbreitet. Allein mit Freiwilligkeit ist aber kein schnelles Handeln in Krisenzeiten möglich. So können wir mit Tempo des Klimawandels nicht Schritt halten. Und nicht nur China, der weltgrößte Emittent ist gefordert. Wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen. In Deutschland war bereits beim maßvollen „Heizungsgesetz“, das den Umstieg von Öl- und Gaskesseln auf erneuerbare Energien über einen (zu) langen Zeitraum regelt, das Geschrei groß. Der Vorwurf der Überforderung in Richtung Habeck war noch einer der harmlosesten. Nichtsdestotrotz stellt dieses Gesetz einen wichtiger Klimaschutz-Baustein dar. Und nach der Dekarbonisierung der Wärme stünde nun die im Transportsektor an. Aber auch bei E-Mobilität hakt es. In China verbreiten sich die Autos schneller als in Deutschland und deutsche Hersteller verlieren im Reich der Mitte Marktanteile. Weitere Schritte stehen an: die Dekarbonisierung der Stahl und Zementindustrie und vor allem um den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2030. Das dürfte der aktuell größte verfügbare Hebel zur CO2-Minderung sein.
Unser CO2-Budget: Konto überzogen?
Global gesehen stellt sich natürlich die Frage, wieviel Treibhausgase überhaupt noch ausgestoßen werden dürfen, um das vertraglich vereinbarte Klimaziel „unter 2 Grad plus, möglichst nur 1,5 Grad“ zu erreichen. Wie groß ist unser restliches CO2-Budget? Da kursieren unterschiedliche Zahlen, wobei die des Weltklimarats IPCC aus dem ersten Teil des 6. Sachstandsberichts von 2021 offensichtlich schon überholt sind. Für das 1,5 Grad Ziel dürfen laut der Forscher des Imperial College London nur noch 247 Mrd. Tonnen Kohlendioxid emittiert werden, um mit einer fünfzigprozentigen Wahrscheinlichkeit noch die 1,5 Grad plus zu erreichen. (3) Mit dem aktuellen Jahresausstoß von 41,6 Mrd. Tonnen CO2 (4) wäre dann das Budget in etwa sechs Jahren aufbraucht. Der deutsche Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU teilte im Oktober 2024 mit, das globale CO2-Budget betrage unter gleichen Bedingungen zwischen 231 und 380 Mrd. Tonnen, im Grunde eine Bestätigung der Londoner Angabe. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung PIK wiederum geht bei fünfzigprozentiger Wahrscheinlichkeit von nur 200 Gigatonnen als globales Maximum für das 1,5-Grad-Ziel aus. Diese Meldung verbindet das PIK mit dem Vorschlag, das Absaugen von CO2 aus der Luft, das mengenmäßig momentan überhaupt keine Rolle spielt, zu verstärken und die Wirtschaftlichkeit dieser Technik durch Einbindung die CO2-Entnahme in den Emissionshandel zu erhöhen.
Deutschland und die Welt
Auf der COP 29 wird wohl auch die Frage aufgeworfen, ob wir Deutsche unsere Hausaufgaben gemacht haben. Die sieben SRU-Sachverständigen haben das zentrale Regelwerk in Deutschland, das Klimaschutzgesetz unter die Lupe genommen. Aber nach ihren Berechnungen liegt Deutschland mit dem KSG keineswegs auf 1,5-Grad-Kurs, sondern landet hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 1,75 und 2 Grad. So weit zur angeblichen deutschen Vorreiterrolle beim globalen Klimaschutz. Weder ist das KSG mit seinen Mengenangaben und dem Absenkpfand für Klimagase auf die Einhaltung der globalen Klimaschutzziele von Paris 2015 ausgerichtet, noch ist das Konzept eines maximalen CO2-Budgets in der deutschen Klimapolitik verankert. Nach der Expertise des SRU wurde das für die maximal 1,5 Grad Erderwärmung zielführende CO2-Budget hierzulande höchstwahrscheinlich bereits bis 2021 aufgebraucht und das der EU insgesamt wird bereits 2027 verfrühstückt sein. (5) Wenn es nur noch darum geht, 2 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten, bliebe natürlich noch etwas mehr Zeit. Für maximal 1,75 Grad Celsius Erderwärmung stehen den Deutschen bei linearer Reduktion der Emissionen mit 67 % Wahrscheinlichkeit noch etwa 12 Jahre Zeit zur Verfügung, so der SRU. Während sich viele also auf einem guten Weg zur Klimaneutralität wähnen, läuft uns in Wirklichkeit die Zeit davon. Obwohl die Treibhausgase in der EU und in Deutschland letztes Jahr stärker sanken als in den USA, die von China und Indien sogar noch stiegen, gibt es überhaupt keinen Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Erst recht nicht, wenn man neben den aktuellen auch die historischen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung in Rechnung stellt. (2)
Alles in allem liefert die Wissenschaft also höchst beunruhigende Zahlen. Erst in einigen Jahren wird sehen, ob 2024 der Emission-Peak überhaupt schon erreicht wurde. Ununterbrochen wird Kohle, Öl und Gas gefördert, werden neue Quellen erschlossen, weil die Nachfrage nach Erdgas, Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl für Kraftwerke, Heizungen, Fahr- und Flugzeuge anhält. Es sieht ganz so aus, als würde die Menschheit gerade die Chance verpassen, die Klimaschäden in engen Grenzen zu halten. (rk)
Quellen:
(1) „Wo die Welt steht“, Christoph von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 25.10.2024
(2) „Emissions Gap Report 2024“, UNEP, Nairobi, 2024
(3) „Weltweites CO2-Budget kleiner als zuletzt angenommen“, Der Spiegel online, 30.10.2023
(4) „Global Carbon Project 2024. Briefing key messages”, Universität Exeter, 14.11. 2024
(5) „Wo stehen wir beim CO2-Budget? Eine Aktualisierung“, Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen, Oktober 2024
Wie geht klimaverträgliches Bauen?
klimaseite.info, 12.11.2024
Hier ist tatsächlich ein dickes Fragezeichen angebracht, denn der Gebäudesektor und die Baubranche sind weltweit für 38 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. (1) Das Treibhausgas wird bei der Herstellung der Baustoffe, beim Bauen und bei der Energieversorgung (Wärme, Strom) der Gebäude während der Nutzung emittiert. Hinzu kommt das Müllproblem: 60 Prozent der Abfälle stammen vom Abriss oder Umbauten.In Deutschland fallen jährlich 200 Mio. Tonnen Bauschutt an, mehr als die Hälfte des gesamten Abfalls. Den Ausstoß an Treibhausgas kann man auf verschiedene Weise zwar reduzieren, aber nicht auf null bringen. Es sei denn, jede Bautätigkeit würde eingestellt, und das will ja keiner. Dennoch scheint die Feststellung des Spiegel kaum übertrieben, wenn er resümiert: „Das globale Bauwesen ist der größte Umweltverschmutzer der Welt“. (1) Das sollte Anlass genug für ein paar grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Klimaschutz bei neuen Bauprojekten sein und die sollten schon möglichst früh im Planungsprozess einsetzen. Wenn wir erst einmal Straßen, Brücken, Tunnels außer Acht lassen und uns auf Gebäude konzentrieren, dann beginnt eine vorausschauende Planung nicht etwa bei den Baustoffen, deren Gewinnung, Aufbereitung und Transport zur Baustelle natürlich auch schon Energie frisst und oft genug mit Landschaftszerstörung verbunden ist.
Neubau oder Renovierung?
Davor steht die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt ein Neubau sein muss oder ob ein bestehendes Gebäude für den gewünschten Zweck umgestaltet werden kann, was in der Regel jedoch auch mit Bautätigkeit verbunden ist. Beim Umbau kommt darauf an, welche Wünsche das Gebäude am Ende zu erfüllen hat und wie hoch der Aufwand dafür ist. Der kann ganz erheblich sein, vor allem, wenn die Grundrisse verändert, also nichtragende Mauern eingerissen und an anderer Stelle neu gesetzt werden. Das ist bei Umnutzung von Nichtwohngebäuden für Wohnzwecke in der Regel der Fall, oft auch beim Umbau von Wohnhäusern. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Aufwand bei fälliger Erneuerung des Dachstuhls, Trockenlegung der Kellerräume durch außen liegende Spundwände oder bei Einbau von Fußbodenheizungen. Wenn die Bausubstanz besser in Ordnung ist, geht es vielleicht um eine Außenwanddämmung und um Austausch der Fenster, weil diese Außenbauteile bei altem Standard zu viel Heizwärme durchlassen.
Baumaterialien und neue Haustechnik sind nicht nur Kostenfaktoren, sondern zunächst auch mit zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden, auch wenn sie über ihre jahrzehntelange Lebensdauer die Einsparung von Energie und Kohlendioxid bewirken, wie eine Wärmedämmung. Die pauschale Aussage, eine Umrüstung von Bestandsgebäuden sei generell „besser“ als der Neubau, ist sicher nicht richtig. Nur der direkte Vergleich und die genaue Bilanzierung möglicher Varianten in puncto Kosten, Ressourcen und CO2 bringen Klarheit. Dabei gilt es konsequenterweise von der „Wiege bis zur Bahre“ zu denken, also von den Baustoffen, der Herstellung der Materialien und Technikkomponenten, über den Einbau, die Nutzung, bis zu Abriss, Recycling, Wiederverwendung oder Entsorgung. Was die Sache nicht gerade einfach macht.
Nach dem Lebensende des Gebäudes ist noch einiges zu „herauszuholen“, wenn auf Trennbarkeit und Recyclingfähigkeit geachtet wurde, aber das geschieht in Planung und Baupraxis hierzulande noch viel zu wenig. Genaues Hinschauen bei der Auswahl alle Materialien lohnt also in Sinne einer Kreislaufwirtschaft, macht sich aber schon während der Nutzung des Gebäudes in puncto Wohngesundheit positiv bemerkbar. Denn Arbeits- und Innenräume sollen so schadstofffrei als möglich sein. Nur zur Erinnerung: Feuerhemmender Asbest und giftiges PCB in Dehnungsfugen zwischen Betonteilen war lange Zeit „State of the art“, aber diese Baustoffe stellen heute gesundheitsgefährdende Altlasten dar, die von Fachleuten mit Schutzausrüstung und unter hohem Aufwand beseitigt werden müssen. Sorgfältige Planung kann also nicht nur für eine gute Klimabilanz des Gebäudes, sondern auch für gutes Raumklima sorgen. Aus gesundheitlichen Gründen lohnt sich vor allem im Innenausbau die nähere Beschäftigung mit dem Material, seien es Fußbodenbelag, Wandfarben oder Kleber.
Wieviel Energie steckt in den Baustoffen?
Der Energieaufwand für die Gewinnung der Grundstoffe Sand, Schotter, Kies, die Herstellung von Zement, Beton oder Ziegelsteinen, von Dachsparren, Fensterrahmen oder Wärmedämmung wird als „graue Energie“ bezeichnet. Meist ist damit auch die fällige Energie für Transport, Einbau und -nach Abriss- für Abtransport und Entsorgung gemeint. Diese Prozesse und Verfahren sind in aller Regel mit CO2-Emissionen verbunden, die zur Klimabilanz des Gebäudes in der Nutzung, also durch Beheizung, Warmwasserbereitung, Lüftung oder Kühlung, durch Pumpen oder Aufzüge, addiert werden müssen. In welchem Verhältnis das während Lebensdauer erzeugte CO2 zu dem vorher und nachher emittierten stehen, hängt sehr von Bauweise, Material, Nutzfläche, Energiestandard, Wärmeversorgung und Dauer der Existenz ab und ist insofern pauschal kaum zu benennen.
Eine Lösung wäre die Holzbauweise, was bedeutet, möglichst viel vom nachwachsenden Rohstoff Holz, der gleichzeitig das darin gespeicherte CO2 bindet, zu verbauen. Der Charme dieser Bauweise besteht darin, dass großflächig Bauteile, wie etwa die Außenwände, bereits in Hallen einschließlich der Fensteröffnungen und Kabelschlitze vorgefertigt werden können, so dass es nach Antransport auf der Baustelle deutlich schneller vorangeht als bei Massivbauten aus Stein oder Beton. Weil diese konventionellen Materialien schwerer sind als die Holzbauweise, kann auf Flachdächern noch ein Stockwerk draufgesetzt werden, ohne die Statik der Geschosse darunter zu überlasten. Es existieren bereits „Holzhochhäuser“ bis 80 Meter Höhe, wobei bei mehrgeschossigen Bauten die Treppenhäuser und Aufzugschächte aus Brandschutzgründen meist betoniert werden, teilweise auch die Decken. Aber auch bei der Herstellung konventioneller, mineralischer Baustoffe kann Energie eingespart und Kohlendioxid vermieden werden.
Beton: Es kommt darauf an, wie man ihn macht
Da weltweit die meisten Bauten aus stahlverstärktem Beton hergestellt werden, verdient seine Produktion besondere Beachtung. Das Gros des Energieaufwand steckt neben dem Stahl im Bindemittel Zement. Jährlich wird global die enorme Menge von 4 Mrd. Tonnen Zement produziert. Dabei wird pro Tonne Zement eine halbe Tonne Kohlendioxid freigesetzt, so die Faustregel. (1) Bei der Zementproduktion wird gemahlener Kalkstein in -bislang mit Erdgas beheizten- Drehrohröfen bei etwa 1.450 Grad Celsius aus gemahlenem Kalkstein und Ton gebrannt. Dabei entsteht der sogenannte „Zementklinker“ als Vorstufe des Zements. Dieses Brennen kann zur Verbesserung der CO2-Bilanz auch mit Strom erfolgen, der dann natürlich möglichst vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen sollte.
Eine andere Methode führt zum gleichen Ziel: Wände oder Decken aus Beton dünner ausführen und statt Stahl zur Verbesserung der Stabilität Matten oder Fasern aus Karbon bzw. Kunststoff in den Beton mischen. Damit kann die Stärke der Schicht bei gleicher Stabilität halbiert werden, entsprechend weniger Beton ist nötig. Beim Mustergebäude für dieses Verfahren namens „Cube“ in Dresden wurden Karbonmatten erfolgreich zur Stabilisierung eingesetzt.
Natürlich kann das bei der Zementherstellung entstehende CO2 direkt in Werk auch abgeschieden und unterirdisch verpresst werden, wie vom Hersteller Cemex in Rüdersdorf geplant. Außerdem ist hier vorgesehen, die Abwärme in ein Nahwärmenetz einzuspeisen. Allerdings ist damit erst eines der 50 Cemex-Zementwerke weltweit dekarbonisiert. (2) Auch andere große Zementhersteller sind bemüht, ihr Produkt klimafreundlicher zu machen. Die Firma Heidelberg Materials will im Werk in Geseke dazu reinen Sauerstoff für das Brennen von Kalkstein nutzen („Oxyfuel-Verfahren“). Das Gasgemisch im Ofen hat dann einen hohen CO2-Gehalt, was die Abscheidung erleichtert. Weil momentan die CO2-Deponierung ausschließlich unter dem Meeresboden erlaubt ist und die dafür notwendigen Pipelines bislang nur auf dem Papier existieren, soll das abgeschiedene Kohlendioxid per Bahn und auf der Schiene nach Wilhelmshaven transportiert werden. Von der Sammelstelle wird das CO2 dann in Tanks auf die Nordsee verschifft, zu einer Plattform der Wintershall Dea, nicht zufällig einem Gas- und Ölförderunternehmen. (3) Dort wird das Klimagas schließlich unter dem Meeresboden verpresst. Die schwedische Firma Cemvision, ein Start-up der Branche, schlägt einen anderen Weg bei der Zementherstellung ein. Statt Kalkstein verwendet es kalziumreiche Reststoffe, etwa aus der Stahlindustrie, um so das Kohlendioxid komplett zu vermeiden.
Gänzlich auf Zement als Bindemittel zu verzichten, funktioniert auch, wenn man stattdessen den Beton flüssige Kunstharze beimischt. Dann spricht man vom „Polymerbeton“. Alle diese Verfahren machen den Beton natürlich nicht billiger. Die CO2-Abscheideanlage in Geseke, eine veritable Fabrik neben dem Drehrohrofen, wird wohl fast 500.000 Euro kosten. Deutschland und die EU fördern solche Techniken mit hohen Summen. Dennoch wird beispielsweise erwartet, dass die Tonne CO2-freier Zement von Heidelberg Materials zunächst das Doppelte der konventionell hergestellten Menge kostet.
Wieviel Fläche soll es denn sein?
Die zweite Grundsatzfrage wäre bei Wohngebäuden die nach der tatsächlich erforderlichen Gewerbe- und Wohnfläche, entsprechend den Bedürfnissen der späteren Nutzer und Bewohner. Selbst in unseren Großstädten, wo Wohnraum knapp und teuer ist, steigt der Flächenbedarf bei Bauherren, Käufern und Mietern. Die Fläche einer Wohnung lag 2022 im Bundesdurchschnitt bei 92,2 m², die pro Person bei 47,4 m² (4). Letzteres bedeutet eine Steigerung um 2,6 Prozent. Das klingt nicht nach viel, summiert sich aber bei 85 Mio. Einwohnern. Obwohl vielköpfige Familien seltener und Einpersonenhaushalte häufiger werden, gibt es eine Tendenz zu großen Wohnungen und Einfamilienhäusern. Das häufig anzutreffende Ideal vom „Häuschen auf dem Land“ ist allerdings ein wenig umwelt- und klimaverträgliches Modell. Ein Wohnflächenbedarf von 200 m² erscheint für eine junge, vierköpfige Familie nicht übertrieben hoch, aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, sieht es schon anders aus. Für zwei Menschen würde nämlich auch eine Wohnung von 70 m² in einem Mehrfamilienhaus genügend Platz bieten. Einfamilienhäuser mit Garten bringen eine Reihe von Problemen mit sich. Neben Wohnhaus und Garage versiegeln oft gepflasterte Wege und die Zufahrt zur Garage den Boden. Wohngebiete mit vielen Einfamilienhäusern vergrößern automatisch die Versorgungsnetze der Kommunen, führen im Vergleich zu Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern zu längeren Leitungen für Wasser, Abwasser, Strom und Erdgas; zu weiteren Wegen für Busse oder Müllabfuhr und zu höheren Kosten für Bau und Unterhalt dieser Infrastruktur. Mit Nachhaltigkeit hat diese Bauweise also wenig zu tun. Eine gute Wärmedämmung und eine Solaranlage auf dem Dach können die Negativbilanz zwar etwas aufhübschen, aber nichts Grundsätzliches ändern. Siedlungen mit Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften, die im Durchschnitt nur geringfügig mehr Energieeffizienz und Ressourcenschonung beitragen, sind häufig auch am Rande von Städten vorzufinden. Solche aufgelockerten und durchgrünten „Gartenstädte“, werden aber Zug um Zug nachverdichtet, entsprechend der wirtschaftlichen Logik, bei der es gilt, den teuren Baugrund optimal auszunutzen.
Im Wohngebäudebestand sind fast 80 Prozent der Häuser Einfamilien- und Zweifamilienhäusern (EFH und ZFH). Städte und Kommunen sind allerdings gut beraten, wenn sie im Zuge der Bauleitplanung keine neuen Wohngebiete mit EFH oder ZFH mehr ausweisen, sondern nur für den Geschosswohnungsbau.
Alte Gebäude voller Wertstoffe, die Stadt als Mine
Da Eisen und Kupfer noch Geld bringen und per Magnet gut vom großen Rest getrennt werden können, gelten sie als Wertstoffe. Bei einem Mehrfamilienhaus von 53 Wohneinheiten an 70 m2 fallen durchschnittlich 177 Tonnen Stahl und 1,8 Tonnen Kupfer und 1,4 Tonnen Aluminium an, ebenfalls recyclingfähig. Demgegenüber allerdings 2.587 Tonnen Beton und 1.850 Tonnen Ziegel, um die beiden größten Fraktionen zu benennen. Hier sind allerdings die Deponie oder Downcycling die Regel, Wiederverwendung von Material oder Bauteilen die Ausnahme. Doch das Problembewusstsein wächst. Baustoffbörsen bieten Vollholzparkett, Fensterrahmen, Ziegel oder Fliesen; Teile, denen bei Renovierungen oder bei Neubauten ein zweites Leben eingehaucht wird. Es geht auch eine Nummer größer. Selbst die Plattenbauten aus DDR-Zeiten müssen nicht in den Shredder. Die Bauingenieurin Angelika Mettke hat in Cottbus 80 Betonteile aus einem zum Abriss freigegebenen Plattenbau für den Neubau eines Sportlerheims verwendet. Und das ist kein Einzelfall. Die Firma Ecosoil realisiert 15 bis 20 solcher Projekte im Jahr. Der Bauunternehmer Axel Bretfeld sagt dazu, bei Beton rechne man normalerweise mit einer Lebensdauer von 50 Jahren, aber „nach 50 Jahren fällt bei ordnungsgemäßer Nutzung kein Beton auseinander“. (5) Er rechne mit einer Nutzungsdauer von 100 Jahren und mehr. Das dürfte stimmen, gilt aber wohl nicht für Straßenbrücken, die hoher Belastung durch den Verkehr ausgesetzt sind, bei denen der stabilisierende Stahl unter der Einwirkung von Wasser und Streusalz nach ein paar Jahrzehnten zu rosten beginnt.
Städte, in denen ja ständig Gebäude abgerissen und neu gebaut werden, hat die Wissenschaft für das „urban mining“ auserkoren. Penibel werden von Forschenden die Wertstoffe erfasst und hochrechnet, um auf das Volumen, das enorme Einsparpotenzial an Rohstoffen, Energie und CO2 hinzuweisen. Aber dieses Wissen trug bislang nur wenig Früchte. Es bleibt vorerst bei Modellprojekten, denn die gängige Baupraxis bedeutet: Abriss, Deponie und Neubau mit neuen Baustoffen und -materialien.
Gute gedämmte Effizienzhäuser
Ob Neubau oder Altbausanierung: Auch und vor allem durch einen guten Wärmeschutz der Gebäudehülle lassen sich Wärmeenergie einsparen und CO2-Emissionen vermeiden. Dabei geht es um alle Außenflächen, also Dach, Bodenplatte, Fenster, Außenwand. Da hat sich die letzten Jahrzehnte einiges getan. Angetrieben wurde der Fortschritt von den innovativen Architekten der „Passivhäuser“, das sind Gebäude, die dank hervorragender Dämmung mit einem Minimum an Heizwärme auskommen. Die stammt von elektrischen Heizelementen in der Zuluft, ein konventioneller Heizkessel wird überflüssig. Das ist noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange, denn es existieren auch bereits hocheffiziente Gebäude, „Plusenergiehäuser“, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen und so zum „Kraftwerk“ werden. Meist weisen sie neben einer sehr guten Wärmedämmung eine Photovoltaikanlage auf, die Strom für die Wärmepumpenheizung erzeugt. Wenn die eigene PV-Anlage übers Jahr gesehen den Hausstrom und den Strom für die Wärmepumpe abdeckt, ist das Gebäude im Betrieb klimaneutral. Bei entsprechender Größe und einem Akkuspeicher bleibt dann ein „Plus“ in Form von Solarstrom für das Elektroauto übrig.
Über Jahrzehnte wurden gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stetig erhöht, angefangen bei der Wärmeschutzverordnung (ab 1984), über die Energiesparverordnung EnEV (ab 2002) bis zum Gebäudeenergiegesetz GEG (ab 2020), dem sogenannten „Heizungsgesetz“. Bei der Heiztechnik macht das GEG nun den entscheidenden Schritt weg von den fossilen Energieträgern hin zur klimafreundlicheren Alternativen. Darin besteht die oft verkannte Qualität des verpönten Heizungsgesetzes. Und es ist „technologieoffen“, denn neben den Wärmepumpen erlaubt das GEG eine ganze Reihe von anderen Heizungen. Eine weitere oft gehörte Kritik, die „Überforderung“ der Bürger, greift bei näherer Betrachtung ebenfalls nicht, denn Habecks Gesetz gewährt großzügige Ausnahmen und Übergangsfristen für den Kesseltausch. Neben der Wärmeversorgung als Teil der Haustechnik enthält das GEG auch Bestimmungen zum Sonnenschutz, Lüftung und Kühlung. Den Kern dieses Gesetzes bildet jedoch die Gebäudehülle, wie schon bei der EnEv der Fall. Der Wärmeschutz von außen bestimmt zusammen mit den eingesetzten Energien, der Art der Beheizung und Kühlung die Energieeffizienz, die Kosten und die CO2-Emissionen während der Nutzung des Gebäudes.
Gebäudeinnovation spart Energie, CO2 und Kosten
Die öffentliche Hand fördert energetische Altbausanierung, Kesseltausch und der Neubau von Effizienzhäusern finanziell. Im Zuge einer umfassenden Sanierung lässt sich der Verbrauch an Heizenergie bei Mehrfamilienhäusern von 110 bis 130 Kilowattstunden pro m2 und Jahr halbieren. Im Neubau geht ist nochmal deutlich weniger. Neben Deutschland ist auch in den Nachbarländern Österreich und in der Schweiz enormes Know How im Bereich energieeffizientes Bauen und Sanieren entstanden. Trotz dieser Erfolgsstory bleibt festzuhalten, dass der Gebäudesektor für mehrere Jahre das Limit des Klimaschutzgesetzes überschritten hat. Hauptursache: Bei den Altbauten geht die Wärmedämmung, der Austausch von älteren Fenstern, Öl- oder Gaskesseln nur schleppend voran. So bewegt sich die Wärmewende im Gebäudebereich trotz vieler Vorteile und trotz der Notwendigkeit der CO2-Minderung zu Zeit auf der Kriechspur. (rk)
Quellen:
1 „2020. Global Status report for Buildings and construction. Executive summary”, UNEP, Nairobi, 2020
2 „Wunder am Bau“, Ullrich Fichtner, Der Spiegel, 05.10.2024
3 „Betonköpfe denken um“, Philip Bethge, Der Spiegel, 28.09.2024
4 „Unser Beton soll grüner werden“, Carlotta Böttcher, Die Zeit, 30.10.2024
5 Website des Umweltbundesamts, www.umweltbundesamt.de
6 „Neues Leben für die alte Platte“, www.tagesschau.de, 12.12.2022
Der Kampf um Heizungsgesetz und Wärmepumpen
klimaseite.info, 17.09.2024
Ein Rekordsommer geht zu Ende, bereits Mitte September ist es herbstlich, ja geradezu winterlich in Deutschland mit Tagestemperaturen, die kaum über 10 Grad Celsius steigen. Höchste Zeit, sich mit der Heizung zu beschäftigen, mag sich mancher Hausbesitzer denken. Falls die alte kaputt ist, wird zunächst der Heizungsmonteur angerufen. Wenn die Reparatur zu teuer kommt oder nichts mehr zu machen ist, muss eine neue Heizung her, am besten eine, die ohne die fossilen Energieträger Erdgas und Heizöl auskommt. Dafür ist die elektrische Wärmepumpe inzwischen die Technik der Wahl. Mit Hilfe von Strom, der ja in Deutschland zu mehr als der Hälfte inzwischen aus erneuerbaren Quellen kommt, nutzt sie Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser, um mit einer Kilowattstunde Strom das Drei- oder Vierfache an Wärme zu erzeugen. Soweit das Prinzip dieser klimafreundlichen Technik. Zu ihrer Unterstützung warb Bundesminister Habeck bei Stiebel Eltron, die in der Nachfrageflaute steckt, für Wärmepumpen und nahm pressewirksam einen Schrauber zu Hand, was zumindest dieser Firma zusätzliche Nachfrage bescherte.
Hausbesitzer halten an alter Technik fest
Denn die Wärmepumpe hat Werbung nötig. 2023 wurden 790.500 Gasheizungen verkauft und nur 356.000 elektrische Wärmepumpen. Im ersten Halbjahr 2024 schaut es nicht viel besser aus: 223.000 Gaskessel, 55.000 Ölkessel und nur 90.000 Wärmepumpen, unterm Strich ein Minus von 54 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Die Hersteller klagen über Absatzprobleme. Auch die Marktpräsenz bleibt stark hinter anderen Ländern, wie Italien, Frankreich, Norwegen und Schweden zurück, wo teilweise in der Hälfte der Heizungskeller Wärmepumpen stehen. Bei uns ist das momentan bei gut einem Viertel der Bestandsgebäude der Fall, nur im Neubau überwiegt die Wärmepumpe bei den Heizsystemen. Die Wärmewende in Deutschland ist also längst noch nicht so weit wie die Stromwende. Mit dem „Heizungsgesetz“ sollte es eigentlich auch bei der Wärme vorangehen, aber das Gesetz gilt vielen als verunglückt. Was steht drin zum Thema Heizen?
- Bestehende Heizungen mit Heizöl und Erdgas sollen im Regelfall nach 30 Jahren ausgetauscht werden.
- Sie dürfen dennoch weiterlaufen bis längstens 2044, sofern sie intakt sind oder repariert werden können. Je nach Art des Hauses und Leistung des Heizkessels gibt es unterschiedliche Regelungen und Fristen.
- Neue Heizungen müssen -zeitlich gestaffelt- mit mind. 65% erneuerbaren Energien laufen. Neben der Wärmepumpe ist auch eine ganze Reihe anderer Heizsystemen möglich. Die notwendige Wärme kann im Gebäude erzeugt oder von außen zugeführt werden (Fern- und Nahwärme).
Wo bleibt die Wärmewende?
Von einem zwangsweisen Austausch funktionierender Heizungen ist hier also nicht die Rede. Erdgas und Heizöl, bei deren Verbrennung CO2 entsteht, dürfen 30 Jahre und länger genutzt werden. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Lebensdauer von Kühlschränken oder Autos beträgt 10 bis 15 Jahre, also maximal die Hälfte dieser Zeitspanne. Und die finale „Deadline“ dieser fossilen Wärmeerzeuger liegt gerade mal ein Jahr vor dem der geplanten Klimaneutralität des ganzen Landes.
Die Kritik „handwerklich schlecht gemacht“ bezieht sich überwiegend auf den im Frühjahr 2023 durchgestochenen Entwurf des Heizungsgesetzes, der gar nicht in den Bundestag kam. Dennoch gilt dieses Gesetz in weiten Teilen der Presse und der Öffentlichkeit als misslungen oder „vermurkst“, so jüngst Philipp Bovermann in der SZ. Aber wer sich tiefergehend und mit Sachkunde damit beschäftigt, kommt durchaus zu einem anderen Urteil. Habecks Gesetz ist trotz einiger Schwächen ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung von Gebäuden und führt zur Minderung der CO2-Emissionen in diesem Bereich.
An dem Vorwurf „schlecht kommuniziert“ ist schon eher was dran. Auf jeden Fall wurde der Bedeutung des Gesetzesvorhabens und der Bezug zum Klimaschutz nicht klar. Vielleicht hätte Habeck eine „Wärmewende“ ausrufen sollen, ähnlich wie Bundeskanzler Scholz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine sicherheitspolitische „Zeitenwende“ ankündigte. Dass Habeck federführend dafür gesorgt hat, die Gaslücke nach dem Wegfall des russischen Erdgases rasch zu schließen und später der Absatz von Gasheizungen in die Höhe ging, entgegen seiner Empfehlung, künftig keine Gasheizungen mehr zu installieren, ist durchaus von einer gewissen Ironie.
Habeck und seine Grünen standen in der von Bild angestoßene Kampagne und dem folgenden Sturm der Entrüstung alleine da. Er wurde durch die Indiskretion oder Intrige kalt erwischt. Zudem war er in der Koalition mit einer FDP gefangen, die sich auf die Seite der Opposition schlug und mit einer passiv-desinteressierten SPD. Dabei hätte speziell Bundesbauministerin Geywitz (SPD) allen Grund gehabt, sich einzubringen. Der Vorläufer des neuen „Gebäudeenergiegesetzes“ (GEG), so die korrekte Bezeichnung für das Heizungsgesetz, die Energiesparverordnung (EnEV) lag nämlich lange Zeit in der Zuständigkeit der Bauministerien. Außerdem musste ihr „Wärmeplanungsgesetz“ ohnehin mit Habecks Gesetz synchronisiert werden, denn die Wärmeerzeugung in Kraftwerken und die Verteilung, etwa durch Fernwärme, ist auf die Gebäude abzustimmen. Dies ist mit beiden Gesetzen gelungen, ein zukunftsfähiger Rahmen ist gesetzt.
Populismus gegen Verbote
Aus Klimaschutzsicht fehlt es allerdings an Tempo. Die Umstellung auf klimafreundliche Heizung und Warmwasserbereitung verläuft mit diesen Leitplanken deutlich zu langsam, was der unsäglichen, gleichwohl noch fortdauernden Verbotsdebatte geschuldet ist. Aber die oft gehegte und geäußerte Hoffnung, mit Information, gutem Zureden und finanzieller Förderung ließen sich die deutschen Klimaschutzziele für 2030 und 2045 erreichen, ist illusorisch. Jede Krise -siehe Pandemie- erfordert eine Regierung, die vor Geboten und Verboten nicht zurückschreckt, auch die Klimakrise.
Jens Spahn (CDU) hat nun mit Blick auf die nächste Bundestagswahl schon angekündigt, den Bürgern wieder die freie Wahl bei der Heizungstechnik zu lassen, wenn seine Partei ans Ruder käme, die Tatsache ignorierend, dass sein Parteivorsitzender Friedrich Merz sich ausdrücklich zur Wärmepumpe bekannte. O-Ton Spahn: „Im Bestand wird es mit uns keinen brachialen Zwang zum Heizungsaustausch geben.“ Allerdings ist dies weder Inhalt noch Ziel des Gebäudeenergiegesetzes. Spahn versprach, die CDU werde Klimaschutzziele mit Augenmaß umsetzen, „nicht mit der Brechstange“. Oder eben gar nicht. Von einer künftigen CDU-geführten Bundesregierung ist also eine Zielverfehlung mit Ansage zu erwarten. Whatabautismen und Populismus a la Spahn pflastern den Weg zur Macht. Der Streit um das Gebäudeenergiegesetz kann als Lehrstück dafür gelten, wie Oppositionsparteien mit Medienunterstützung Klimaschutzmaßnahmen aushebeln können. Und als Beispiel, wie Populismus wirkt, wie erfolgreich Sprücheklopfen sein kann. Habeck äußerte im Rückblick auf die Debatte um das Gesetz, sie habe ihm die Grenzen des politisch Machbaren und gesellschaftlich Vermittelbaren gezeigt. So war es wohl. Aber so kriegt man natürlich kein Tempo in die Techniktransformation und so sind auch die Klimaschutzziele im Gebäudesektor nicht zu erreichen.
Vom Verbrenner zum Stromer
Gibt es aktuell einen „Kulturkampf um die Wärmepumpe“, wie Der Spiegel das titelt? Dann haben erleben wir gerade auch einen Kulturkampf um das Elektroauto. Denn in beiden Fällen steht eine ausgereifte Technik zur Verfügung, um mithilfe von Strom fossile Energieträger zu ersetzen und CO2-Emissionen vermeiden, die akute Probleme hat, sich auf dem Markt durchzusetzen. Da der Verkehrs- und der Gebäudesektor die im Klimaschutzgesetz fixierten Limits für CO2 seit Jahren überschreiten, könnten potenzielle Kunden beim Neukauf einer Wärmepumpe und eines E-Autos einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten; auch, wenn man bedenkt, dass beide Techniken jahrzehntelang ihren Dienst tun werden. Zwar können sie inzwischen nicht mehr als „innovativ“ gelten, wie etwa die von der FDP ersehnten Flugtaxis, aber bringen doch unvergleichlich größeren Nutzen. Allerdings scheint die viel gepriesene Technologieoffenheit bei Wärmepumpen und E-Autos ihre Grenzen zu haben, wie die aktuellen Absatzkrisen zeigen. Die Skeptiker und Schlechtmacher können einen Erfolg verbuchen, die Hersteller und der Klimaschutz haben hingegen das Nachsehen. (rk)
Quellen:
„Kulturkampf um die Wärmepumpe“, Der Spiegel, 07.09.2024
„Statusreport: Wärme“, www.bdew.de, am 16.09.2024
Website der Deutschen Energieagentur, www.deea.de, am 16.09.2024
Website der Statista GmbH, statista.com, abgerufen am 16.09.2024
Wird das Grundwasser weniger?
klimaseite.info, 15.08.2024
Mehr als zwei Drittel unseres Trinkwassers aus der öffentlichen Wasserversorgung stammen aus Grundwasservorkommen. Wir blicken jetzt auf eher feuchtes Winterhalbjahr und ausgesprochen nasse Monate Mai und Juni inclusive weiträumiger Überschwemmungen in Süddeutschland zurück. Konnte dieser Regenüberschuss die regenarmen Jahre von 2018 bis 2020 ausgleichen, in denen das Grundwasser mancherorts bedenklich zurückging?
Messungen und Ergebnisse
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist dieser Frage nachgegangen und dokumentiert das Ergebnis im Internet, auch in Form einer digitalen Karte. An 82 Referenzmessstellen wurden Daten aus den Jahren 1991 bis 2020 ausgewertet. Tatsächlich sanken die Pegelstände in den Dürrejahren merklich. 2019 und 2020 lag nur ein Drittel der Pegel im Normalbereich, zwei Drittel wiesen aber Niedrigststände auf. Ganz anders die erste Jahreshälfte 2024, in der sich bei drei Vierteln der Pegel ein hoher bis sehr hoher Grundwasserstand zeigte. Für die Neubildung von Grundwasser ist aber nicht allein die Regenmenge entscheidend, sondern auch der Umfang der Bodenversiegelung, die Durchlässigkeit des Bodens und die Beschaffenheit der grundwasserführenden Schichten. Nach Aussage von Fachleuten kann sich das Grundwasser teilweise innerhalb von Stunden auffüllen, es kann aber auch Jahrzehnte dauern.
Ungleiche Verteilung
Bemerkenswert waren die regionalen Unterschiede der Regenmenge. In den zwölf Monaten von Juni 2023 bis Juni 2024 gaben es einen enormen Regenüberschuss gegenüber dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 im Voralpenland, in Teilen Baden-Württembergs, im Saarland, in der Lüneburger Heide und in einer Zone vom Rheinland über Hamburg bis Schleswig-Holstein. Unterdurchschnittlich bis schlecht waren die Regenfälle in den neuen Bundesländern. Niedrige Pegel waren zuletzt vor allem im südlichen Brandenburg und in Sachsen zu beobachten. So hat sich der Pegelstand in Mülsen (Sachsen) beispielsweise nicht nur nicht erholt von den Trockenjahren, sondern sank sogar weiter ab. Auch im Erzgebirge und im Bayerischen Wald sind ein Drittel der Pegel noch unterdurchschnittlich hoch.
Leichte Entspannung der Lage
Die Forscher ziehen folgendes Fazit: „Das Niederschlagsdefizit der vergangenen Jahre hat sich nicht über Gesamtdeutschland gleichförmig reduziert und in einigen Regionen gar nicht.“ Wenn der gesamte Wasserhaushalt des Landes betrachtet wird, also neben Grundwasser auch die Bodenfeuchte und die Gewässer, so liegen neue Erkenntnisse vor. Die Forschung hat die Aussage eines US-Geologen, der Satellitendaten der GRACE-Mission auswertete und von einem Wasserverlust von 2,4 Kubikkilometern Wasser von 2000 bis 2022 ausging, was etwa dem Wasser im Bodensee entspräche, auf Drittel dieser Menge unten korrigiert. Grund zur Entwarnung ist das aber nicht, denn Deutschland bräuchte unter dem Strich und auf längere Sicht mehr Niederschlag, um die Wasser-Defizite auszugleichen. Denn mit steigenden Temperaturen verdunstet natürlich auch mehr Wasser aus den oberen Schichten des Bodens, bevor es das Grundwasser erreicht. Aber hinsichtlich der Frage, ob künftig Regenüberschüsse zu erwarten sind, lassen die Klimamodelle noch keine klare Antwort zu.
Regen nutzen, Trinkwasser schonen, Wasser sparen
Die Regenmenge ist kaum beinflussbar, aber den Regen könnte man vermehrt in Talsperren, Zisternen, Regentonnen auffangen und er müsste stärker genutzt werden, etwa zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung, um die Trinkwasservorräte zu schonen. Außerdem sollte der fast ungebremste Trend zur Bodenversiegelung durch neue Häuser, Parkplätze, Straßen, Gewerbegebiete im Umfang von 55 ha pro Tag, was in Summe pro Jahr der Fläche der Stadt Hannover entspricht, dringend gestoppt werden. Ein Großteil des von befestigten Flächen abfließenden Regenwassers landet nicht im Grundwasser, sondern in der Kläranlage bzw. im nächsten Fluss. Wenn es darum geht, den Wasserverbrauch einzuschränken, ist aber in erster Linie die Industrie als größter Wasserverbraucher gefragt. Denn durch die Wasserversorgung der öffentlichen Hand wurden 2019 in Deutschland 20,71 Mrd. m³ Wasser gewonnen, für industrielle und gewerbliche Zwecke jedoch 15,36 Mrd. m³, davon 2,29 Mrd. m³ Grund- und Quellwasser. Mit 12 Mrd. m³ dominiert das Flusswasser als Wasserquelle, das vor allem für Kühlzwecke in Kraftwerken genutzt wird. Vor allem aufgrund des gesunkenen Kühlwasserbedarfs von Atom- und Kohlekraftwerken ging die gesamte Wasserentnahme aus der Umwelt im letzten Jahrzehnt um etwa ein Siebtel zurück.
Quellen:
„Wieder volle Speicher“, von Eichhorn/Müller-Hansen/Kraus/Schnuck, Süddeutsche Zeitung, 05.08.2024
Website der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), www.bgr.de
Website des Statistischen Bundesamts, www.destatis.de
Wasserstoff hat Zukunft
klimaseite.info, 05.08.2024
Noch ist nicht klar, wo „grüner“ Wasserstoff aus der Wasserelektrolyse mit Ökostrom in ausreichender Menge und zu akzeptablem Preis herkommen soll. Es gibt in Deutschland gerade mal etwa 40 Elektrolyseure, die eine kleine Menge dieses teuren Stoffs produzieren. Einstweilen ist der allergrößte Teil „grau“. Er wird aus fossilen Kohlenwasserstoffen durch Dampfreformierung hergestellt. Wenn das dabei entstehende CO2 abgetrennt und gespeichert wird, ist von „blauem“ Wasserstoff die Rede. „Türkis“ wird er in dieser Nomenklatur, wenn im Zuge einer Methan-Pyrolyse statt CO2 fester Kohlenstoff entsteht, der leichter deponiert werden kann als das gasförmige Kohlendioxid oder aber als Chemie-Grundstoff Verwendung findet. Es gibt noch weitere Herstellungswege mit den entsprechenden Farben, die voraussichtlich keine wesentliche Rolle spielen können. Momentan stammt in Deutschland erzeugte Wasserstoff allerdings zu über 90 Prozent aus fossilen Quellen. Das soll sich ändern. Mitte Juni arbeiten an etwa zwei Dutzend Standorten „Power to gas“ -Anlagen, Elektrolyseure, die mit vor allem mit Windstrom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff spalten.
Wo Wasserstoff Sinn macht
Klar ist aber, dass kein Weg am Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorbeiführt, vor allem die Stahl- und Zementproduktion ist ohne grünen Wasserstoff nicht klimaneutral zu bewerkstelligen. Auch Gaskraftwerke sollen Anschluss an ein entsprechendes Pipeline-Netz erhalten und künftig mit Wasserstoff befeuert werden. Das dritte Einsatzgebiet nach der Industrie und dem Kraftwerksbereich ist der Transportsektor, wobei H2 als Kraftstoff im Güterverkehr und in der Luftfahrt vermehrt zum Einsatz kommen, aber für Pkw in der Nische bleiben dürfte. Ähnlich wird es bei Gasheizungen in Gebäuden laufen. Nur ein kleiner Teil der neuen H2-ready-Gaskessel wird Wasserstoff aus dem Netz beziehen können, weil das Wasserstoffnetz für Großabnehmer konzipiert ist. Dieses „Kernnetz“ ist zunächst für eine Länge von 9.700 km geplant. Zum Vergleich: das aktuelle Erdgasnetz umfasst 550.000 km, das Fernleitungsnetz allein 42.400 km.
Gas-to-Power
In einer Situation, in der genauere Prognosen hinsichtlich der Marktentwicklung schwierig sind, stellte die Bundesregierung mit ihrer Wasserstoffstrategie die Leitlinien vor. Sie will mit dem „Kraftwerksicherungsgesetz“ Anreize für den Neubau von wasserstofffähigen Kraftwerken schaffen. Insgesamt sind 12,5 Gigawatt (GW) Kraftwerksleistung vorgesehen. Es werden fünf GW Leistung bei wasserstofffähigen Kraftwerken ab dem achten Betriebsjahr und weitere fünf GW Leistung bei Gaskraftwerken ohne zeitliche Vorgaben zur Umstellung auf Wasserstoff ausgeschrieben. Weitere zwei Gigawatt Kraftwerksleistung sollen durch Modernisierung bzw. Umrüstung im bestehenden Kraftwerkspark hinzukommen und 500 Megawatt (MW) Kraftwerksleistung sind für ein Wasserstoff-Kraftwerk geplant, das sofort und vollständig mit Wasserstoff betrieben werden kann. Ergänzend will die Bundesregierung auch 500 MW Leistung für Strom-Langzeitspeicher ausloben.
Aber diese Instrumente und Leitplanken stellen die Zielerreichung noch nicht sicher. Momentan ist nur klar, dass die Produktionskapazitäten in Deutschland enorm ausgebaut werden müssen. Das heißt: Zubau an Elektrolyseuren, um den Bedarf zu decken, den der Nationale Wasserstoffrat bei grünem Wasserstoff für Jahr 2030 mit 53 bis 90 Terawattstunden prognostiziert. Dies sei zum Erreichen der Klimaschutzziele notwendig.
Zielzahlen sind zunächst nur blanke Theorie. In der Praxis ist aktuell Nachfrage in größerem Umfang von seitens der Stahlindustrie erkennbar, bei den Gaskraftwerken aber noch nicht. Laut SZ „verschiebt die Kraftwerkstrategie des Bundes den Umstieg auf Wasserstoff bis in die späten Dreißigerjahr und damit die Nachfrage nach dem nötigen Brennstoff“. Bislang aber nur ein Bruchteil der Erzeugungskapazität gebaut oder zumindest in Planung. Zusätzlich zur Eigenproduktion muss deshalb Wasserstoff importiert werden, und zwar mehr als die Hälfte des Bedarfs im Jahr 2030, auch in der Erwartung, dass diese Importe günstiger kommen als die Produktion im Lande.
Woher kommt das grüne Gas?
Nach einer Studie der Agora Energiewende könnten Mitte der 2030er Jahre könnten rund 60 bis 100 Terawattstunden (TWh) grüner Wasserstoff aus benachbarten Ländern eingeführt werden. „Damit ließe sich ein wesentlicher Teil des von der Bundesregierung für 2030 angegebenen Neubedarfs an Wasserstoff und Derivaten decken.“ Der Import per Pipeline sei dabei die günstigere Variante gegenüber den Tankern. Als Varianten beim Transport per Schiff stehen noch wenige spezielle H2-Tanker und Ammoniak-Tanker zur Verfügung. Der Flüssigwasserstoff wird nahe der Verdampfungstemperatur, bei minus 250 Grad transportiert. Durch die unvermeidbare Erwärmung auf dem Transportweg geht allerdings Wasserstoff verloren. Im zweiten Fall muss das im Ammoniak gespeicherte H2 dann wieder durch Cracken zurückgewonnen werden: ein Vorgang, der ebenfalls mit Verlusten verbunden ist.
Agora-Energiewende kommt zu folgender Bewertung der Importmöglichkeiten: „Der entscheidende Nachteil von schiffsbasierten Transportoptionen gegenüber Pipelines ist hingegen eine deutlich niedrigere Effizienz. Die zum Transport per Schiff nötige Umwandlung des Wasserstoffs in Derivate und die Rückumwandlung sind mit hohen Energieverlusten verbunden. Die dafür notwendige Technik, zum Beispiel Ammoniakcracking, wurde bisher noch nicht großskalig demonstriert, so dass auch technische Risiken eine Rolle spielen. Der Wasserstofftransport per Pipeline ist hingegen mit sehr geringen Energieverlusten verbunden und technisch ausgereift.“
Liefer-Kandidaten im Süden sind nach dieser Studie im Süden die Länder Spanien und Tunesien auf der Basis von Sonnenstrom, im Norden Dänemark und Norwegen auf der Basis von Windstrom. Bundeskanzler Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Meloni einigten sich im November 2023 auf Kooperation bei einem Pipelineprojekt, das Nordafrika, Italien, Österreich und die Schweiz mit dem Bundesland Bayern verbinden soll. Aber diese sogenannten „Partnerschaften“ mit mehr als 20 Ländern weltweit sind noch keine Verträge, sondern nur Absichtserklärungen.
Der Markt und der Preis entscheiden
Das Manko an diesen Ausbauplänen besteht darin, dass inzwischen zwar eine ganze Reihe von Pilot- und Modellprojekten existieren, aber sich bislang noch kein nennenswerter Markt entwickelt hat. Die Wasserstoff-Technologien dürften noch längere Zeit teuer sein. Letztlich ist aber der Abnahme-Preis für diesen „Champagner der Energiewende“ entscheidend. Die Bundesregierung versucht nun mit finanzieller Förderung den Aufbau einer Infrastruktur voranzutreiben. Im Juli hat Bundesminister Habeck Förderbescheide über 4,6 Mrd. Euro an rund 20 Unternehmen übergeben, die Leitungen, Wasserstoff-Produktionsanlagen oder Speicher bauen wollen.
Wasserstoff hat also Zukunft in Deutschland. Letztlich sind grüner Wasserstoff und die damit verbundenen Techniken alternativlos auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der Zug ist bereits aufs Gleis gesetzt. Obwohl Ziele, Rahmenbedingungen und Umsetzungsstrategie geklärt sind, wird es wohl noch etwa 15 Jahre dauern, bis dieses „grüne“ Gas dem fossilen Erdgas ernsthaft Konkurrenz macht. (rk)
Quellen:
„Woher Wasserstoff kommen könnte“, Michael Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung, 04.07.2024
„Deutschlands Wasserstoff-Zukunft: Europäische Pipelines als Schlüssel“, Pressemitteilung der Agora Energiewende, 04.07.2024
„Wasserstoffimporte Deutschlands. Welchen Beitrag können Pipelineimporte in den 2030er Jahren leisten?“, Studie der Agora-Energiewende, Juni 2024
„Wie die Energiewende vorankommt“, tagesschau.de, 07.08.2024
Kreuzfahrten – die Schmutzfahne der Traumschiffe
klimaseite.info, 29.06.2024
Nach Umsatzeinbruch der Pandemiejahre erholt sich die Kreuzfahrtbranche wieder. Letztes Jahr waren fast drei Millionen Deutsche auf großer Fahrt. Da in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Klimakrise weiter gewachsen ist, sind Unternehmen und Reiseveranstalter sehr um ein grünes Image bemüht. Es gilt, den ramponierten Ruf der Kreuzfahrten aufzubessern. Die Internationale Seefahrtorganisation hat denn auch das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ausgegeben. In 26 Jahren klimaneutral? Davon ist man aktuell nicht bloß nach Jahren weit entfernt. Das hindert die Branche aber nicht daran, unverdrossen Erfolgsmeldungen abzusetzen, wie etwa bei der Jungfernfahrt von „Mein Schiff 7“ der TUI Cruises, die „unvergessliche Genussmomente“ verspricht und stolz darauf verweist, das Schiff, ausgelegt für 2.900 Gäste, werde künftig „mit grünem Methanol“ betrieben.
Die Gegenwart ist allerdings eher trist und grau. Momentan fährt das Schiff mit einem fossilen Treibstoff, nämlich Marinediesel, einem fossilen Treibstoff, bei dessen Verbrennung im Motor jede Menge Treibhausgasgase frei werden. Häufiger als der Marinediesel kommt in der Schifffahrt das schmutzigere Schweröl zum Einsatz, schlicht deshalb, weil es billiger ist. Die entstehenden Luftschadstoffe sind allerdings ein großes Problem. Denn bei diesem Treibstoff gehen Ruß, Feinstaub, Stickoxide und Schwefelverbindungen durch den Schornstein, es sei denn, sie werden durch sogenannte „Scrubber“ ausgewaschen. Wenn diese Brühe allerdings einfach ins Meer abgelassen wird, wie das nach häufig geschieht, leidet die Umwelt trotzdem. Zwar verfügt ein Großteil der Kreuzfahrtschiffe tatsächlich über solche Scrubber, aber nur ein Teil entsorgt die Waschflüssigkeit ordnungsgemäß an Land. Momentan ist es nicht weit her mit sauberen Antrieben und Treibstoffen, denn auch bei TUI Cruises liegt der Schweröl-Anteil bei 65 %, bei der Branchengröße MSC sogar bei 75 %.
Beim TUI Schiff 7 sind im Maschinenraum zwar einige Rohleitungen für Methanol installiert, aber die für diesen Treibstoff vorgesehenen Viertaktmotoren befinden sich noch in der Entwicklung und werden wohl erst Anfang 2026 eingebaut. Sollte sich diese Technik bewähren, überlegt man bei TUI, die Schiffe 1 bis 6 entsprechend umzurüsten. AIDA Cruises fährt mit Flüssigerdgas, das zwar weniger Luftschadstoffe verursacht als die Diesel-Variante, aber ebenfalls das Klima schädigt. Beide Unternehmen hatten ursprünglich ambitioniertere Klimaziele: Klimaneutralität bis 2040. Inzwischen will man sich aber bis 2050 Zeit lassen. Das Unternehmen MAERSK, dessen Containerschiffe Güter auf allen Weltmeeren transportieren, ist an dieser Stelle ehrgeiziger und bleibt bei 2040 als Zieljahr für die Klimaneutralität.
Großtechnisch stammt Methanol als wichtiger Grundstoff der chemischen Industrie überwiegend aus fossilen Quellen. Ausgangspunkt ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff als Synthesegas. „Grünes“ Biomethanol aus Pflanzenresten (Zuckerrohr) wird in Brasilien häufig als Fahrzeug-Treibstoff verwendet. Auch die Produktion von (dann klimaneutralem) Methanol aus Wasserstoff (via Elektrolyse mit Ökostrom) und Kohlendioxid ist möglich. Da es Methanol bereits Motoren antreibt, dürfte die Umsetzung auf die Anforderungen eines Kreuzfahrtschiffs kein Hexenwerk sein.
Der springende Punkt ist jedoch der Preis für den Treibstoff. Denn die Reedereien sind in einem harten Wettbewerb, der sie zwingt, genau zu überlegen, welchen Anteil der Mehrkosten sie den Kunden zumuten können. Gleichzeitig geht der Kreuzfahrt-Trend zu größeren Schiffen. TUI plant mit der „Intuition“ Serie für 4000 Passagiere. Klimawandel hin oder her – die Branche setzt auf Expansion und eine gute PR. Die Minderung der Treibhausgase hält allerdings nicht Schritt mit dieser Entwicklung und die Klimaneutralität lässt ohnehin noch lange auf sich warten. Somit ist aus Sicht des Klimaschutzes für die nächsten 10 Jahre von der Buchung einer Kreuzfahrt abzuraten. Immer mehr Bewohner von Küstenstädten, die unter dieser Form des Massentourismus leiden, sehen das ähnlich. (rk)
Quellen:
„Gesucht: klimaschonende Kreuzfahrten“, Lea Hampel/Sonja Salzburger, Süddeutsche Zeitung, 22./23.06.2024
„Pack das Methanol in den Tank – irgendwann“, Antje Blinda, Spiegel online, 23.06.2024
Was die Wirtschaft will
www.klimaseite.info, 20.06.2024
Die Regierungskoalition ist sich wieder mal uneinig. Diesmal geht es darum, wie das Geld in den nächsten Jahren zu verteilen ist. Seit Wochen wird über Wirtschaftshilfen und ein Investitionspaket der Bundesregierung diskutiert, um der schwächelnden Konjunktur auf die Beine zu helfen. Nachdem letztes Jahr das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent zurückging, stimmen die jüngsten Prognosen von Wirtschaftsforschern zwar etwas optimistischer. Drei Institute rechnen für 2024 mit einem Zuwachs des BIP zwischen 0,2 und 0,4 Prozent. Wenn es mehr sein soll, müssen jedoch zusätzlich staatliche Mittel eingesetzt werden, um die privaten Investitionen anschieben.
Vorbild könnte die USA sein, denn die Biden-Regierung hat im August 2022 ein riesiges Investitionsprogramm zum Ausbau von Infrastruktur, erneuerbaren Energien und Klimaschutz gestartet, das sich jetzt auszahlt, und auf das Wirtschaftsminister Habeck neidvoll blicken dürfte. Mit dem amerikanischen „Inflationsbekämpfungsgesetz“ werden 370 Mrd. Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz, außerdem 64 Mrd. Dollar für das Gesundheitswesen bereitgestellt: die „größte Investition gegen Erderwärmung in der US-Geschichte“ laut Tagesschau. Der Spiegel resümiert: „Der Inflation Reduction Act“ (IRA) hat zu einem massiven Anstieg der Investitionen in grüne Technologien in den USA geführt.“
Staatliche Töpfe sind leer
Und die Bundesregierung? Die fest eingeplanten 60 Mrd. Euro aus dem Topf nicht abgerufener Corona-Gelder konnten nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) überführt werden. Das Gericht sah hier die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse tangiert. Die Bundesregierung hat dann noch ein Bruchteil dieser Summe für Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere Fördermittel für Heizungsumstellung und energieeffiziente Gebäude, für klimafreundliche Stahlproduktion, den Bau von Akkuspeicher- und Chipfabriken zusammengekratzt, wobei letztere nicht zwingend unter Klimaschutz zu subsummieren sind. Denn der KTF, aus dem auch Mittel für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft flossen, ist zur eierlegenden Wollmilchsau geworden, aber dafür mittlerweile nicht genügend ausgestattet. Finanzminister Lindner aber will weder neue Steuern, noch will er neue Kredite aufnehmen und beharrt auf der Einhaltung der Schuldenbremse. Auf der anderen Seite werden die Rufe nach einen Konjunkturprogramm immer lauter; von Seiten der Wirtschaftsforscher, wie auch aus der Wirtschaft.
Der Vorschlag der Industrie
Der Bundesverband der deutschen Industrie BDI schlägt nun ein Investitions-Paket von 400 Mrd. Euro verteilt auf 10 Jahre vor. Bei diesen Maßnahmen geht es bei weitem nicht nur industriespezifische Aspekte, sondern um eine breite Palette von Industriehilfen, Klimaschutz, Infrastrukturmaßnahmen und -man höre und staune- auch in die Bildung sollen Milliarden Euro fließen. Das sind Investitionen in die Zukunft und der BDI hat offensichtlich verstanden, dass es angesichts des Fachkräftemangels nicht angehen kann, dass 12 Prozent der Schulkinder die Schule ohne Abschluss verlassen, um nur eines die vielen Probleme im deutschen Bildungssystem zu benennen. Und so sollen die Investitionen eingesetzt werden:
- 101 Mrd. Euro im Bildungssektor
- 158 Mrd. Euro in Verkehrsinfrastruktur (Schienen- und Straßenverkehr), davon allein 64 Mrd. Euro in den Ausbau des ÖPNV
- 56 Mrd. Euro Gebäude und Wohnen (sozialer Wohnungsbau, Sanierung, Fernwärme etc.)
- 23 Mrd. Euro Dekarbonisierung der Wirtschaft und grüne Technologien
- 18 Mrd. Euro für Tank-, Ladeinfrastruktur und grüne Kraftstoffe
- 20 – 40 Mrd. Euro für wirtschaftliche Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien (Batterie, Mikroelektronik)
Finanziert werden sollen diese rund 400 Mrd. Euro durch ein Sonderprogramm außerhalb des regulären Haushalts, ähnlich wie die 100 Mrd. Euro für Bundeswehr, Rüstung und nationale Sicherheit, also durch neue Schulden, die aber nicht unter die per Grundgesetz abgesicherte Schuldenbremse fallen. Finanzminister Lindner sperrt sich dennoch. Die Frage ist, wie lange noch seinen Widerstand durchhält. Das dürfte ein Thema bei den aktuellen Verhandlungen zum Haushalt 2025 werden.
Muss die Wirtschaft jetzt in die Presche springen?
Zwar hat der Sektor der Wirtschaft in den letzten Jahren das Limit des Klimaschutzgesetzes (KSG) nicht überschritten, aber Unternehmen und Verbände wissen, dass noch viel CO2 einzusparen ist bis zum Ziel der Klimaneutralität. Und sie müssen wohl auch einen zusätzlichen Beitrag für die Sektoren Gebäude und Verkehr liefern, die die Messlatte des KSG letztes Jahr erneut gerissen haben. Denn das kürzlich novellierte Klimaschutzgesetz erlaubt diese Quer-Verrechnung, die man „Lastenteilung“ nennen, aber auch als Abschieben der Verantwortung bezeichnen könnte. (rk)
Quellen:
„Wirtschaftsforscher blicken zuversichtlicher auf die Konjunktur“, Der Spiegel online, 13.06.2024
„Industrie fordert Milliardentöpfe gegen Investitionstau“, Der Spiegel online, 12.06.2024
„Lindner gehen die Unterstützer aus“, Süddeutsche Zeitung, 13.06.2024
„Kongress verabschiedet Klima- und Sozialpaket“, tagesschau.de, 13.08.2022
„USA erleben Boom bei grünen Technologien, Der Spiegel online, 29.05.2024
Der Abschied von der Kohle ist fällig
klimaseite.info, 12.04.2024
Auch wenn das die verbliebenen 20.000 Beschäftigten der Branche nicht gern hören wollen: Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist der Schlüssel für Deutschland, die nationalen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 zu erreichen, denn laut Umweltbundesamt macht die Kohlekraft 70 Prozent der CO2-Emissionen der Stromerzeugung aus. Zwar ist der Strom ist nur eine Energieform und Treibhausgase kommen aus mehreren Emissionssektoren, fossile Energieträger werden auch verbrannt in Motoren, Turbinen, Heizungen oder reinen Heizkraftwerken, aber an der Schlüsselstellung der Kohle ändert das nichts. Der hohe Emissionsanteil der Kohle ist auch insofern bemerkenswert, als Braunkohle und (importierte) Steinkohle in 2023 etwa ein Viertel zur gesamten Stromerzeugung beitrugen. Dieses ungünstige Verhältnis kommt nicht von ungefähr, denn die Energieerzeugung aus Stein- und erst recht aus Braunkohle führt zu sehr hohen CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom, von den ebenfalls emittierten Luftschadstoffen gar nicht zu reden: Braunkohle: 1.137 g/kWh, Steinkohle 853 g/kWh gegenüber Erdgas 381 g/kWh. Die Verstromung von Braunkohle, von Greenpeace als der „schmutzigste Brennstoff der Welt“ bezeichnet, verursacht also fast dreimal so viel CO2 wie aus Erdgas. Zum Vergleich: Strom aus erneuerbaren Energien liegt bei den Emissionsfaktoren, ob aus Wasser-, Windkraft oder Photovoltaik, weit unter 100 g/kWh.
Gaskraft als das kleinere Übel
Darum wäre ein Ersatz von Kohlekraft- durch Gaskraftwerke mit einer nicht unerheblichen Einsparung an CO2 verbunden. 2018 war das letzte Jahr des Steinkohleabbaus in Deutschland, die Zechen wurden geschlossen. Wird 2030, wie von den Grünen gefordert, die Kohleverstromung eingestellt? Wann stehen die riesigen Schaufelbagger, die im Braunkohle-Tagebau enorme Löcher in die Landschaft reißen, still? Im Koalitionsvertrag hatten sich die drei Parteien der Ampelkoalition noch auf ein unverbindliches „idealerweise“ geeinigt, aber die Gesetzeslage fordert den Ausstieg erst mit Ablauf des Jahres 2038. Das Umweltbundesamt stellt jedoch unmissverständlich klar, dass der Kohleausstieg bis 2030 erforderlich ist, damit die Treibhausgase entsprechend dem Klimaschutzgesetz bis 2030 um 65 % reduziert werden können. In diesem Zusammenhang sind die Emissionen aus der Energieerzeugung zu halbieren.
Aktuell ist jedoch auch klar, dass die erneuerbaren Energien (EE) die Lücke, die die Kohlekraft hinterlässt, nicht komplett schließen können, schon gar nicht bis 2030. Die Bundesregierung hat ein Ökostromziel von „nur“ 80 % vorgegeben und selbst das wird nicht leicht zu erreichen sein. Um den voraussichtlichen Strombedarf in sechs Jahren zu decken, der vermutlich um ein Drittel größer sein wird als die 450 Mrd. kWh von 2023, muss die Gasverstromung hochgefahren werden, zum einen zur Abdeckung der nötigen Strommengen, zu anderen zum Lastausgleich und zur Abdeckung der Nachfragespitzen im Süden. Denn gerade, wenn Stromspeicher fehlen und das Übertragungsnetz noch kräftig ausgebaut werden muss, geht es nicht nur um die bloße Strommenge. Gaskraftwerke können schneller hochgefahren werden und flexibler auf Engpässe reagieren als Kohlekraftwerke. Insofern drängt der Austausch der Reservekapazitäten gerade auf. Die Prognosen gehen allerdings auseinander, wie viele Gaskraftwerke mit welcher Leistung bis 2030 entstehen müssen. Das Energiewirtschaftliche Institut in Köln gibt 23 Gigawatt an, BDI Präsident Russwurm hält einen Zubau von 43 Gigawatt für notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Marktdurchdringung wird wesentlich vom Preis für Erdgas und vom CO2-Preis im europäischen Zertifikatehandel abhängen.
Ökostrom wichtiger als Kohlestrom
2022 hatte die Kohlekraft noch einen Anteil von 33,2 % an der Stromerzeugung, wurde aber bereits damals vom Strom aus erneuerbaren Quellen mit einem Anteil von 46,3 % überflügelt. Ein ähnliches Bild bot sich 2023, dem bisherigen Rekordjahr der Ökostromerzeugung, mit einem EE-Stromanteil von 56,0 %, während der Kohlestromanteil auf 26,1 % sank. Nach einer im Internet verfügbaren Liste das Umweltbundesamts sind momentan noch 68 reine Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer Bruttoleistung von 36,5 Gigawatt in Betrieb. Laut Kohleausstiegsgesetz von 2020 soll die Kohle-Kraftwerksleistung 2022 auf 30 GW und 2030 auf 17 GW reduziert werden, der Ausstieg ist allerdings erst für Ende 2038 vorgesehen.
Große Energieversorger orientieren sich bereits neu. EnBW will bis Ende 2028 aus der Kohleverstromung aussteigen und investiert verstärkt in EE, so wie RWE. Diese Investitionen tragen nicht zur CO2-Minderung bei, sondern versprechen auch wirtschaftlichen Ertrag. Eine Studie über Kohlekraftwerke in über 70 Ländern kommt zu dem Ergebnis, dass 2.300 von 2.500 dieser Kraftwerke gewinnbringend ersetzt werden könnten, da Solarstrom und Windstrom fast überall günstiger zu produzieren sei. Auch für Deutschland wird bei der Investition von 120 Mrd. Euro für Photovoltaikanlagen, große Batteriespeicher und Windräder ein dickes Plus von 550 Mrd. Euro nach 30 Jahren prognostiziert. Mithin ist der Kohleausstieg aus der Sicht des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit geboten. (rk)
Quellen:
„Raus aus der Kohle – und dann?“, Nakissa Salavati, Süddeutsche Zeitung, 05.04.2024
„Stromerzeugung 2023“, Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 087 vom 07.03.2024
„Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 – 2022“, Climate Change, 20/2023,
Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, Mai 2023
„Erneuerbare Energien deckten 2023 erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs, Pressmitteilung, bdew.de, 18.12.2023
„Kohlekraftwerke ersetzen lohnt sich“, tagesschau.de, 30.11.2023
„Treibhausgasminderung um 70 Prozent bis 2020: So kann es gehen!“, Positionspapier des Umweltbundesamts, September 2021
Extremwetter 2023 – das neue Normal?
klimaseite.info, 22.03.2024
Die Bilanz der Weltwetterorganisation WMO für 2023 beunruhigt. WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo rief anlässlich der Präsentation des Berichts die „Alarmstufe Rot“ aus. Zum einen wurde ein Anstieg der globalen, mittleren Oberflächentemperatur um 1,45 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau gemessen. Damit wurde letztes Jahr das untere Limit, das sich die UN- Klimakonferenz 2015 in Paris setze, fast erreicht, wobei sich dieses Ziel auf den langjährigen Durchschnitt, nicht auf ein einzelnes Jahr bezieht. Außerdem listet der „Klimazustandsbericht 2023“ eine ganze Reihe von Extremwetterlagen, klimabedingten Naturkatastrophen und einschneidenden Entwicklungen auf, die in dieser Häufung auffällig sind: In der Antarktis schmolz das Meereis um 1 Million Quadratkilometer ab, was mit der ebenfalls gestiegenen Temperatur der Ozeane korrespondiert. Da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt, stieg auch der Meeresspiegel. Die Alpengletscher verloren Eis in einem nie dagewesenen Ausmaß und es war mit Abstand das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Folge der Hitze und langanhaltenden Trockenheit waren Dürren, Ernteausfälle und Waldbrände. Manche Regionen litten wiederum unter zu viel Regen und weiträumigen Überschwemmungen. Erschwerend hinzu kamen Hurrikans, Zyklone und Wirbelstürme, die ebenfalls große Schäden verursachten. Gleichzeitig wurde weltweit noch nie so viel CO2 ausgestoßen, wie 2023, womit wir bei der Ursache des Klimawandels wären. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erreichte zwar ebenfalls Rekordniveau, aber solange die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger nicht sinken, geht die Erderwärmung weiter. (rk)
Quelle:
„So extrem war das Klima 2023“, Benjamin von Brackel, Süddeutsche Zeitung, 20.03.2024
Mit Atomkraft zurück in die Zukunft?
klimaseite.info, 26.03.2024
Es erinnert ein wenig an die DDR-Nostalgie und ist rational ebenfalls nur schwer zu erklären: die Kernkraft-Nostalgie. Letztes Jahr, bevor die letzten drei deutschen Atomreaktoren vom Netz gingen, war das Unken vor einem Blackout und Stromengpass unüberhörbar. FDP, CSU und CDU wollten nicht von der gefährlichen Technik lassen. Rückblickend und angesichts der Tatsache, dass der gefürchtete Notstand ausblieb, wird jetzt fleißig gestreut, dass Deutschland dafür massenhaft Atomstrom importieren musste. Tatsächlich wurden 2023 erstmal seit 2002 mehr Strom importiert als exportiert, nämlich 9 Mrd. kWh (von insgesamt 510 Mrd. kWh Netzstrom insgesamt), aber im europäischen Strommix. Zur Hälfte stammten die Stromimporte aus erneuerbaren Quellen und nur zu einem Viertel Atomstrom. Ohnehin trugen die verbliebenen Reaktoren 2022 nur noch 6,4 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei, 2023 nur noch 1,5 Prozent: ein nicht vernachlässigbarer, aber durchaus ersetzbarer Beitrag.
Angeschoben von Frankreich haben sich jüngst die europäischen Staaten zusammengefunden, die neue AKWs bauen wollen. Die Pro-Allianz wächst angesichts des fortschreitenden Klimawandels, verspricht die Kernkraft doch nahezu CO2-freien Strom. Allerdings kann man hier von Klimaneutralität nur reden, wenn die grauen Emissionen aus der Gewinnung und Aufbereitung von Uran, dem Bau der Reaktoren und der Herstellung der technischen Komponenten unterschlagen werden.
Die Nostalgie kleidet sich in das Gewand der Innovation. Startups forschen fieberhaft nach neuen Reaktorkonzepten und scheitern reihenweise auf dem Weg vom Konzept über erste Prototypen zur Realisierung auf dem Markt. Aber nicht durchgängig. In Rumänien werden jetzt sechs kleine Nuklearreaktoren (Small Modular Reaktor SMR) gebaut. Sie sollen zeigen, dass ortsnahe Stromerzeugung aus Kernkraft mit diesen Typen machbar und ungefährlich ist. Der Bürgermeister ist euphorisch, die Einwohner reagieren eher skeptisch.
Denn was die Befürworter einfach nicht sehen wollen: Kaum einer will einen Atomreaktor in seiner Nähe haben und für das Endlager gilt das Gleiche. Der zweite blinde Fleck bezieht auf die Gestehungskosten des Atomstroms. Aktuell ist das so ziemlich die teuerste Methode der Stromproduktion, wenn die AKWs neu gebaut werden. Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards und langer Bauzeiten muss die Stromerzeugung teurer kommen als die von großen Photovoltaikanlagen oder Windkraft an Land. Neben der Unterscheidung, ob der Atomstrom aus alten und neuen Anlagen stammt, gibt es hier noch eine weitere Grauzone: die Folgekosten wie Umwelt-, Gesundheitsschäden und Entsorgung, die in Deutschland ja noch ungeklärt ist. Nach Angaben des Statistischen Bundesamt liegen die Folgekosten von Atomkraft im Vergleich zu anderen Energieträgern am höchsten.
Und was die heiß diskutierten neuen Reaktorkonzepte angeht, hat das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in einer aktuellen Studie folgendes nüchternes Fazit gezogen: „In keinem der Länder ist ein Durchbruch abzusehen“. Jedenfalls nicht in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten. Auf die käme es aber an, wollte man dem Klimawandel mit Atomkraft wirksam begegnen. Wenn es länger dauert, kommt vielleicht schon der Fusionsreaktor ins Spiel und diese Technik verspricht Stromerzeugung ohne die Gefahr eines nuklearen GAUs und ohne Endlagersorgen. (rk)
Quellen:
„In keinem der Länder ist ein Durchbruch abzusehen“, Michael Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung, 22.03.2024
„Analyse und Bewertung des Entwicklungsstands, der Sicherheit und des regulatorischen Rahmens für sogenannte neuartige Reaktorkonzepte“,
Ökoinstitut. e.V., TU Berlin, Physikerbüro Bremen, Berlin März 2024
„Der Traum von den Mini-Akw“, tagesschau.de, 21.03.2024
„Eine Allianz für Kernkraft in Europa, tagesschau.de, 21.03.2024
Statistisches Bundesamt, statista.de
Die COP28: Erfolg oder Flop?
klimaseite.info, 24.01.2024
In der langen Reihe von inzwischen 28 UN-Klimaschutzkonferenzen gibt es leider wenig Highlights. Als solches zu benennen wäre die COP15 in Paris mit der gemeinsamen Zielsetzung, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius, maximal aber auf 2 Grad zu begrenzen. Die letzte Veranstaltung in dieser Reihe, die COP28 in Dubai, stand schon aufgrund der Präsidentschaft von Al Jaber, dem Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und CEO eines großen Ölkonzerns, unter keinem guten Stern. Erschwerend hinzu kamen die Kriege in der Ukraine und Israel hinzu, die nach der Flaute während der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Erdöl und Erdgas weltweit anheizten.
Obwohl längst klar ist, dass schnell Schluss sein muss mit der Förderung und Verbrennung fossiler Energieträger fuhren die großen Ölkonzerne letzte Jahr Milliardengewinne ein. Die Anteilseigner der fünf größten börsennotierten Ölunternehmen der Welt – BP, Shell, Chevron, ExxonMobil und TotalEnergies – können für 2023 mit 100 Milliarden US-Dollar (90 Milliarden Euro) Dividende rechnen. Das entspricht zufällig der den Entwicklungsländern schon lange zugesagten Summe an internationaler Hilfe für Klimaschäden. Nach Spiegel-Recherche haben sechzig Banken zwischen 2016 und 2022 mit rund 1,8 Billionen Dollar (umgerechnet rund 1,7 Billionen Euro) internationale Kohle-, Öl- und Gaskonzerne finanziert. Der überwiegende Teil davon waren Kredite zur Förderung fossiler Rohstoffe.
Während UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der COP28 die Vertreter von fast 200 Staaten wieder einmal beschwört („Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens“), während die CO2-Konzentration in der Atmosphäre die neue Rekordhöhe von 420 ppm erreicht, entschwindet das 1,5-Grad-Ziel. Indes wollen viele Politiker und Bürger gerne glauben, die Welt hätte noch Zeit für den Ausstieg aus fossilen Energien, idealerweise bis Mitte des Jahrhunderts, aber davon kann natürlich gar keine Rede sein, Förderung und Verbrauch müssen sofort radikal heruntergefahren werden. Bei den 1,5 Grad Celsius als Maximum der Erderwärmung geht es um Jahre, nicht um Jahrzehnte. Aber auch die Deutschen setzen weiter auf die Fossilen, beim Kauf von Gasheizungen oder Autos mit Verbrennungsmotor. Und diese Neuanschaffungen werden rund 20 Jahre im Einsatz sein. Das wissen Förderländer, Investoren und Ölkonzerne. Diese Tatsache sichert den Absatz der fossilen Brennstoffe und Kraftstoffe auf lange Zeit. Und so musste schon als Erfolg verbucht werden, dass die COP28 erstmals in einem Abschluss-dokument der Weltklimakonferenz die grundsätzliche Abkehr von fossilen Energieträgern beschloss, wobei der Ausstieg nicht terminiert werden konnte.
Genau dagegen hatten sich nämlich 22 erdölexportierende Staaten noch während der Konferenz ausgesprochen. Vor dem Hintergrund des Marktgeschehens (siehe oben) darf ohnehin skeptisch sein, ob der Ausstieg in den nächsten 20 bis 30 Jahren gelingen kann, obwohl auf vielen Anwendungsfeldern alternative, fossilfreie Techniken zur Verfügung stehen. Wie erwähnt, begibt sich die Weltwirtschaft derzeit weiter in fossile Abhängigkeiten. Die Nachricht, dass die nächste UN-Klimaschutzkonferenz COP29 Ende des Jahres erneut von einem Ölförderland, nämlich Kasachstan, ausgerichtet wird, stimmt natürlich auch nicht gerade optimistisch. (rk)
Quelle: Susanne Götze, SPIEGEL Klimabericht, 03.11.2023
Der IPCC-Synthesebericht: Fakten und Prognosen zum Klimawandel
klimaseite.info, 07.04.2023
Die mittlere Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit beträgt laut dem jüngst veröffentlichten Synthesebericht des Weltklimarats IPCC 1,1 Grad. Die World Meteorogical Organization WMO gibt auf seiner Website eine Temperaturerhöhung von 1,14 Grad Celsius im 10-Jahres-Durchschnitt für den Zeitraum 2013-2022 gegenüber im Vergleich zur vorindustriellen Basislinie von 1850-1900 an. Beide Werte weisen ein Plus/Minus hinter dem Komma auf, aber wesentlicher als diese Unschärfe beim Anstieg der globalen Mitteltemperatur sind die großen Unterschiede zwischen den Ländern je nach Breitengrad. Während für Deutschland bereits plus 1,7 Grad Celsius zu Buche schlagen sind weiter nördlich bis zu plus drei Grad.
- Nach derzeitigem Trend, mit den aktuellen Aktivitätsniveau der Staaten, ist laut Weltklimarat eine Erderwärmung von 3,2 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts zu erwarten.
- Bereits bei 3 Grad Celsius Temperaturanstieg ist unter anderem eine Verdoppelung bis Verdreifachung der hitzebedingten Todesfälle in Europa zu befürchten.
- Selbst wenn international alle Zusagen eingehalten würden (und danach schaut es nicht aus), muss man mit einer Erderwärmung von 2,5 Grad rechnen.
- Der Meeresspiegel steigt immer schneller; die Geschwindigkeit hat sich seit 1900 durch die Erderwärmung auf 3,7 mm pro Jahr verdreifacht.
- Bereits bei 2 Grad Erderwärmung wird in Südeuropa ein Drittel der Bevölkerung von Trinkwasserknappheit betroffen sein. Auch die Landwirtschaft und Gartenbau wird darunter leiden.
- Bei einem Temperaturanstieg über 3 Grad Celsius würden sich die Schäden durch Küstenüberflutung bis Ende des Jahrhunderts mindestens verzehnfachen.
- Ökosysteme wie Regenwälder, Feuchtgebiete und Korallenriffe können sich vermutlich nicht schnell genug anpassen und drohen zu verschwinden.
Das Gros der durchgerechneten Klimaszenarien ergibt eine mittlere Erderwärmung zwischen 1,8 und 3,9 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts. Das heißt, der Temperaturanstieg wird mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Spannen liegen. Heißt auch: Das 1,5 -Grad-Ziel von Paris kann wahrscheinlich nicht erreicht werden. Dafür müssten die globalen Treibhausgase schon bis 2030 um 45 % reduziert werden, bis 2035 um zwei Drittel bis zur Mitte des Jahrhunderts um 100 %. Das sind die Notwendigkeiten, über die Politik global und in Deutschland gerne hinwegsieht. Der IPCC moniert außerdem, dass immer noch mehr Geld in fossile Energie und fossile Infrastruktur fließt als in Klimaschutzmaßnahmen.
Der Weltklimarat wurde 1988 von der World Metereological Organization WMO und der UN-Umwelt-organisation UNEP gegründet, fasst regelmäßig die wissenschaftlichen Kenntnisse über den Klima-wandel in Berichten zusammen, die unter anderem auch als Grundlage für die UN-Klimakonferenzen dienen. Der nächste, der 7. Bericht Assessment Report wird in Teilberichten voraussichtlich ab 2027 erscheinen. (rk)
Quelle: „Bangen um das 1,5 Grad-Ziel“, Christoph von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 21.03.2023
